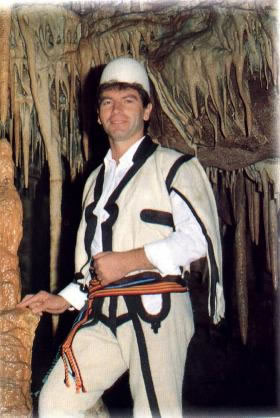Albanesi
Gesperrt
Balkanismen: Albaner-Walachen-Rumänen
Entwicklung der Balkanlinguistik bis Sandfeld
Schon der schwedische Gelehrte Thunmann beschrieb 1774, eineinhalb Jahrhunderte vor Sandfeld, kulturelle und geschichtliche Gemeinsamkeiten der Albaner und der „Wlachen“, aufgrund dessen er als Begründer der Balkanologie angesehen wird. Die Affinität der beiden Völker erklärte er mit ihrer gemeinsamen Herkunft: „Sie [die Albaner] sind Nachkoemmlinge der alten Illyrier, so wie ihre Nachbarn die Wlachen [...] Kinder der Thracier sind“ (S. 240) und es sei „wahrscheinlich, daß beide Völker mit einander verwandt gewesen, daß sie sich mit einander vermischt [...]“ (S. 254). Was die Sprachen der beiden Völker anbelangte, konnte er nur einen Vergleich auf lexikalischer Ebene erstellen („da ich sie [die Sprachen] nicht grammatisch kenne“, S. 175): „ueber siebenzig Wlachische Woerter kommen mit eben so vielen Albanischen ueberein [...]“.
Der Slavist Kopitar nahm die unvollendete Arbeit Thunmanns wieder auf und fand bei einem Textvergleich der Parabel vom verlorenen Sohn in der Fassung der serbischen, bulgarischen und albanischen Sprache sowie dreier rumänischer Dialekte nicht nur lexikalische, sondern auch grammatikalische Übereinstimmungen. Dies veranlasste ihn zu der für seine Zeit sehr moderne Aussage:
So daß also, noch bis auf diese Stunde, nördlich der Donau in der Bukowina, Moldau und Walachey, Siebenbürgen, Ungern, ferner, jenseits der Donau, in der eigentlichen Bulgarey, dann in der ganzen Alpenkette des Hämus, in der ausgedehntsten alten Bedeutung dieses Gebirges, von einem Meere zum andern, in den Gebirgen Macedoniens, im Pindus und durch ganz Albanien nur eine Sprachform herrscht, aber mit dreyerley Sprachmaterie. (S. 253)
Der Slavist Miklosich führte Kopitars Werk fort und erstellte 1862 erstmals eine Liste von „sprachliche[n] Erscheinungen, die auf das alteinheimische Element zurückgeführt werden zu sollen“ (S. 6). Einen vorläufigen Abschluss fanden die Arbeiten auf dem Gebiet der Balkansprachen mit dem Erscheinen von Sandfelds linguistique balkanique.
...........
Thrako-illyrisches Substrat
Das älteste Modell, dass die Übereinstimmungen zwischen den Balkansprachen erklärt, führt diese auf ein Substrat zurück. Schon Thunmann glaubte an eine gemeinsame Herkunft der Albaner und Rumänen:
die Wlachen [...] deren erster Stamm wahrscheinlich mit dem Albanischen einerlei gewesen, aber mit der Zeit, und durch eine stärkere Vermischung mit anderartigen Völkern, auch von demselben sich entfernet hat. Auch hiervon zeuget so wohl die Geschichte als die Sprache“ (S. 246).
Die Albaner sind nach Thunmann „Nachkoemmlinge der alten Illyrier, so wie ihre Nachbarn die Wlachen [...] Kinder der Thracier sind“ (S. 240). Auch Kopitar stützte diese These:
Daß aber ihr [der rum. Sprache, sc.] nichtlateinischer Bestandtheil der illyrischen (heut zu Tage albanesischen) oder doch einer mit dieser sehr nahe verwandten Sprache angehört, zeigen nicht allein viele Wörter dieser Art, die diese beyden Sprachen mit einander gemein haben, sondern mehr noch, und eigentlich entscheidend, der gleiche grammatische Bau diesen zwey Bruder- und Nachbarvölkern, davon das eine, im Gebirge, Form und Materie seiner Sprache gerettet, das andere, im Thale, zwar römische Materie, aber doch nur in seine Form umgegossen, angenommen hat. (S. 253)
Die Substrat-Hypothese blieb im 19. Jahrhundert vorherrschend, Miklosich führte die Balkanismen auf das „alteinheimische[n] Element“ zurück (S. 6).
Im 20. Jahrhundert trat die Substrat-Hypothese mehr und mehr in den Hintergrund, Die wenigen Sprachdenkmäler dieser Sprachen geben gerade in bezug auf ihre grammatische Struktur spärliche Auskunft: inwieweit z.B. der nachgestellte Artikel auf ein thrakisches Substrat zurückzuführen ist, bleibt strittig. Unstrittig sind dagegen die schon von Thunmann beschriebenen Gemeinsamkeiten im albanischen und rumänischen Wortschatz, die u.a. von Solta ausführlich in seinem Buch Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksichtigung des Substrats und des Balkanlateinischen behandelt wird (Kapitel II, S. 11-63).
......
Gewichtung der Balkansprachen und ihrer Dialekte
Auch die dialektale Differenzierung der Balkansprachen löste ein grundsätzliches Problem der Sprachbundtheorie nur unzureichend: Einige Sprachen bzw. Dialekte weisen mehr Balkanismen auf als andere, was eine Zuordnung zum Balkansprachbund schwierig macht. Wie in 3.3.1 (Die „klassischen“ Balkansprachen) beschrieben, entdeckte Kopitar zwei der fünf grammatische Übereinstimmungen des Rumän./ Alban./ Bulgar.. auch im Neugriechischen und Serbischen. Sandfeld dagegen, ich greife seine von mir in 3.3.1 zitierte Aussage nochmals auf, stellte das Griechische, das er als Ausgangspunkt der Balkanismen ansah, mit den drei Kernsprachen gleich: „Il s’agit en premier lieu du grec, de l’albanais, du bulgare et du roumain“; das Serbokroatische sah er nicht im gleichem Maße als Balkansprache an: „souvent aussi du serbo-croate“, während das Türkische „par contre n’entre plus ici en ligne de compte,“ da es an den „concordances générales“ nicht beteiligt ist.
Die Frage, ob nun eine Sprache dem Balkansprachbund angehöre oder nicht, lässt sich also nicht eindeutig mit ja oder nein beantworten. Schaller versuchte dieses Problem dadurch zu lösen, dass er die Sprachen drei (bzw. vier) verschiedenen Gruppen zuordnete:
1. Balkansprachen „ersten Grades“, d.h. die Häufigkeit der Balkanismen ist in diesen Sprachen so hoch, daß sie als „Kernsprachen“ des Balkansprachbundes bezeichnet werden müssen, das geographische Gebiet entsprechend als das „Kerngebiet“ der Balkansprachen. Zu dieser Gruppe von Balkansprachen sind Albanisch, Bulgarisch, Mazedonisch und Rumänisch zu rechnen.
2. Balkansprachen „zweiten Grades“, d.h. Sprachen, die bereits in die Randzone des Balkansprachbundes gehören. Hierzu sind das Neugriechische und das Serbokroatische zu rechnen.
3. Sprachen des Balkans, die keine Gemeinsamkeiten mit den Balkansprachen aufweisen, nämlich Türkisch, während Slowenisch und Ungarisch mit ihrem Sprachgebiet bereits außerhalb der Balkanhalbinsel liegen. (1975, S. 103)
Das „Kerngebiet des Balkansprachbundes“ sieht Schaller als den „Ausgangspunkt der Balkanismen“ (ebd.). Zudem verfeinert er sein Modell noch, indem er auch nach Dialekten differenziert. Bei dem Torlakischen handelt es sich demnach um einen „Balkandialekt ‚ersten Grades’“, bei einigen Mundarten im Norden Rumäniens dagegen um „Balkandialekte ‚zweiten Grades’“ (1975, S. 104ff).
Entwicklung der Balkanlinguistik bis Sandfeld
Schon der schwedische Gelehrte Thunmann beschrieb 1774, eineinhalb Jahrhunderte vor Sandfeld, kulturelle und geschichtliche Gemeinsamkeiten der Albaner und der „Wlachen“, aufgrund dessen er als Begründer der Balkanologie angesehen wird. Die Affinität der beiden Völker erklärte er mit ihrer gemeinsamen Herkunft: „Sie [die Albaner] sind Nachkoemmlinge der alten Illyrier, so wie ihre Nachbarn die Wlachen [...] Kinder der Thracier sind“ (S. 240) und es sei „wahrscheinlich, daß beide Völker mit einander verwandt gewesen, daß sie sich mit einander vermischt [...]“ (S. 254). Was die Sprachen der beiden Völker anbelangte, konnte er nur einen Vergleich auf lexikalischer Ebene erstellen („da ich sie [die Sprachen] nicht grammatisch kenne“, S. 175): „ueber siebenzig Wlachische Woerter kommen mit eben so vielen Albanischen ueberein [...]“.
Der Slavist Kopitar nahm die unvollendete Arbeit Thunmanns wieder auf und fand bei einem Textvergleich der Parabel vom verlorenen Sohn in der Fassung der serbischen, bulgarischen und albanischen Sprache sowie dreier rumänischer Dialekte nicht nur lexikalische, sondern auch grammatikalische Übereinstimmungen. Dies veranlasste ihn zu der für seine Zeit sehr moderne Aussage:
So daß also, noch bis auf diese Stunde, nördlich der Donau in der Bukowina, Moldau und Walachey, Siebenbürgen, Ungern, ferner, jenseits der Donau, in der eigentlichen Bulgarey, dann in der ganzen Alpenkette des Hämus, in der ausgedehntsten alten Bedeutung dieses Gebirges, von einem Meere zum andern, in den Gebirgen Macedoniens, im Pindus und durch ganz Albanien nur eine Sprachform herrscht, aber mit dreyerley Sprachmaterie. (S. 253)
Der Slavist Miklosich führte Kopitars Werk fort und erstellte 1862 erstmals eine Liste von „sprachliche[n] Erscheinungen, die auf das alteinheimische Element zurückgeführt werden zu sollen“ (S. 6). Einen vorläufigen Abschluss fanden die Arbeiten auf dem Gebiet der Balkansprachen mit dem Erscheinen von Sandfelds linguistique balkanique.
...........
Thrako-illyrisches Substrat
Das älteste Modell, dass die Übereinstimmungen zwischen den Balkansprachen erklärt, führt diese auf ein Substrat zurück. Schon Thunmann glaubte an eine gemeinsame Herkunft der Albaner und Rumänen:
die Wlachen [...] deren erster Stamm wahrscheinlich mit dem Albanischen einerlei gewesen, aber mit der Zeit, und durch eine stärkere Vermischung mit anderartigen Völkern, auch von demselben sich entfernet hat. Auch hiervon zeuget so wohl die Geschichte als die Sprache“ (S. 246).
Die Albaner sind nach Thunmann „Nachkoemmlinge der alten Illyrier, so wie ihre Nachbarn die Wlachen [...] Kinder der Thracier sind“ (S. 240). Auch Kopitar stützte diese These:
Daß aber ihr [der rum. Sprache, sc.] nichtlateinischer Bestandtheil der illyrischen (heut zu Tage albanesischen) oder doch einer mit dieser sehr nahe verwandten Sprache angehört, zeigen nicht allein viele Wörter dieser Art, die diese beyden Sprachen mit einander gemein haben, sondern mehr noch, und eigentlich entscheidend, der gleiche grammatische Bau diesen zwey Bruder- und Nachbarvölkern, davon das eine, im Gebirge, Form und Materie seiner Sprache gerettet, das andere, im Thale, zwar römische Materie, aber doch nur in seine Form umgegossen, angenommen hat. (S. 253)
Die Substrat-Hypothese blieb im 19. Jahrhundert vorherrschend, Miklosich führte die Balkanismen auf das „alteinheimische[n] Element“ zurück (S. 6).
Im 20. Jahrhundert trat die Substrat-Hypothese mehr und mehr in den Hintergrund, Die wenigen Sprachdenkmäler dieser Sprachen geben gerade in bezug auf ihre grammatische Struktur spärliche Auskunft: inwieweit z.B. der nachgestellte Artikel auf ein thrakisches Substrat zurückzuführen ist, bleibt strittig. Unstrittig sind dagegen die schon von Thunmann beschriebenen Gemeinsamkeiten im albanischen und rumänischen Wortschatz, die u.a. von Solta ausführlich in seinem Buch Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksichtigung des Substrats und des Balkanlateinischen behandelt wird (Kapitel II, S. 11-63).
......
Gewichtung der Balkansprachen und ihrer Dialekte
Auch die dialektale Differenzierung der Balkansprachen löste ein grundsätzliches Problem der Sprachbundtheorie nur unzureichend: Einige Sprachen bzw. Dialekte weisen mehr Balkanismen auf als andere, was eine Zuordnung zum Balkansprachbund schwierig macht. Wie in 3.3.1 (Die „klassischen“ Balkansprachen) beschrieben, entdeckte Kopitar zwei der fünf grammatische Übereinstimmungen des Rumän./ Alban./ Bulgar.. auch im Neugriechischen und Serbischen. Sandfeld dagegen, ich greife seine von mir in 3.3.1 zitierte Aussage nochmals auf, stellte das Griechische, das er als Ausgangspunkt der Balkanismen ansah, mit den drei Kernsprachen gleich: „Il s’agit en premier lieu du grec, de l’albanais, du bulgare et du roumain“; das Serbokroatische sah er nicht im gleichem Maße als Balkansprache an: „souvent aussi du serbo-croate“, während das Türkische „par contre n’entre plus ici en ligne de compte,“ da es an den „concordances générales“ nicht beteiligt ist.
Die Frage, ob nun eine Sprache dem Balkansprachbund angehöre oder nicht, lässt sich also nicht eindeutig mit ja oder nein beantworten. Schaller versuchte dieses Problem dadurch zu lösen, dass er die Sprachen drei (bzw. vier) verschiedenen Gruppen zuordnete:
1. Balkansprachen „ersten Grades“, d.h. die Häufigkeit der Balkanismen ist in diesen Sprachen so hoch, daß sie als „Kernsprachen“ des Balkansprachbundes bezeichnet werden müssen, das geographische Gebiet entsprechend als das „Kerngebiet“ der Balkansprachen. Zu dieser Gruppe von Balkansprachen sind Albanisch, Bulgarisch, Mazedonisch und Rumänisch zu rechnen.
2. Balkansprachen „zweiten Grades“, d.h. Sprachen, die bereits in die Randzone des Balkansprachbundes gehören. Hierzu sind das Neugriechische und das Serbokroatische zu rechnen.
3. Sprachen des Balkans, die keine Gemeinsamkeiten mit den Balkansprachen aufweisen, nämlich Türkisch, während Slowenisch und Ungarisch mit ihrem Sprachgebiet bereits außerhalb der Balkanhalbinsel liegen. (1975, S. 103)
Das „Kerngebiet des Balkansprachbundes“ sieht Schaller als den „Ausgangspunkt der Balkanismen“ (ebd.). Zudem verfeinert er sein Modell noch, indem er auch nach Dialekten differenziert. Bei dem Torlakischen handelt es sich demnach um einen „Balkandialekt ‚ersten Grades’“, bei einigen Mundarten im Norden Rumäniens dagegen um „Balkandialekte ‚zweiten Grades’“ (1975, S. 104ff).