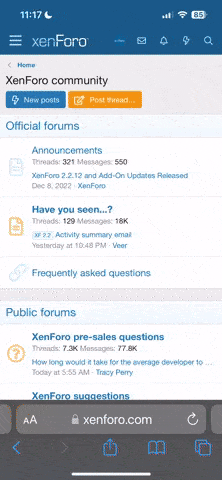lupo-de-mare
Gesperrt
Sterben und sterben lassen
Von Eugen Sorg
Seit dem Zusammenbruch des Kommunismus hat sich in Albanien die Blutrache wie eine Epidemie ausgebreitet. Das archaische Ritual ist Teil des Kanun, eines jahrtausendealten Verhaltenskodex. Der schwache und korrupte Staat ist hilflos. Eine Reportage von Eugen Sorg (Text) und Nathan Beck (Bild)
Streit um Land, oft Anfang der Blutrache: Verwandte von Pjeter Zef Ulaj verstümmelten seine frisch gepflanzten Bäume – er soll verschwinden. (Bild: Nathan Beck)
In Shkodra, der Hauptstadt Nordalbaniens, gibt es ein Quartier mit dem Namen «Blutviertel». Dort leben Familien, die aus Furcht vor Blutrache hergezogen sind – die meisten aus den Dörfern der umliegenden Berge. Blutviertel ist keine offizielle Bezeichnung, und ein Angehöriger der Stadtregierung behauptet, nichts von der Existenz eines solchen Quartiers zu wissen. Alle anderen Leute jedoch, die ich danach frage, wissen sofort, um welchen Stadtteil es sich handelt, und jeder hat auch schon irgendwelche Geschichten darüber gehört. Aber keiner von ihnen war je dort. Es sei nicht ratsam, dorthin zu gehen, meint die Frau an der Rezeption meines Hotels, ohne jedoch genauere Gründe dafür zu nennen. Niemand tue dies, ergänzt ihre Kollegin, als sei dies Erklärung genug. Das stimme, bestätigt später unsere Übersetzerin Anila, eine vife Germanistikstudentin aus Shkodra, sie sei ebenfalls noch nie dort gewesen. Ohnehin, habe ihr ein Freund erzählt, würden am Abend bewaffnete Männer die Zufahrten zum Quartier mit Barrikaden absperren. Anila schluckt kurz, als ich sie auffordere, mich ins Blutviertel zu begleiten, willigt aber ein.
Das Recht der Berge
Unter dem über vier Jahrzehnte herrschenden kommunistischen Regime hatte es keine Blutfehden mehr gegeben. Die Rolle des Bluträchers wurde vom Staat übernommen. Enver Hoxha, der Diktator mit den gepflegten Manieren und dem hübschen, weichen Gesicht, Gründer des ersten atheistischen Staates der Kulturgeschichte, verwandelte Albanien in ein einziges von der Welt abgeschottetes Straflager. Das Trällern eines italienischen Schlagers; ein Schimpfwort über die lausige Qualität des volkseigenen Brotes, den Behörden vom Nachbarn oder Cousin zugetragen; das blosse Androhen von Blutrache – das konnte reichen, damit der Betroffene als «Spion», «ungesundes Element» oder «reaktionärer Schädling» erschossen und dessen gesamte Familie in die Berge deportiert wurde. Das Spitzelwesen war derart durchdringend, dass nicht einmal Liebespaare sich ihre kleinen Geheimnisse zuzuflüstern wagten.
Kaum implodierte der Kommunismus Anfang der neunziger Jahre, wurden wieder Fälle von Blutrache gemeldet. Um die Mitte der neunziger Jahre sassen bereits Hunderte wegen dieses Deliktes in albanischen Gefängnissen. Zum einen waren es generationenalte Abrechnungen, die noch aus präkommunistischen Zeiten stammten, zum anderen waren es neue Fehden. Das Prinzip der Blutrache ist ein Bestandteil des Kanun, des archaischen Gesetzes der Berge, eines 1260 Vorschriften umfassenden Verhaltens- und Ehrenkodex, der über Jahrtausende vom Vater auf den Sohn weitergegeben wurde. Der Kanun überlebte vor allem im schwer zugänglichen katholischen Nordalbanien (und in Teilen des Ko-sovo) die Herrschaft der kulturell überlegenen Römer, Byzantiner, Serben, Türken und offensichtlich auch die gesellschaftliche Folterkammer der Kommunisten. Sein Regelwerk oder vielmehr dessen Geist erwies sich als tief in die kollektive Mentalität eingesenkt, äusserer Beeinflussung kaum zugänglich, als handle es sich um eine neurobiologische Reaktionsmatrix.
Die Übersetzerin Anila hat einige Semester an einer deutschen Uni studiert und verachtet die vormodernen Bräuche eines Teils ihrer Landsleute. Auch für die plötzlich aufgekommene Sitte, kleine Puppen oder Stofftierchen gegen den bösen Blick über den Hauseingängen zu befestigen, findet sie nur spöttische Worte. «Unsinn ist das, dummes, abergläubisches Zeug.» Und im Grunde genommen weiss sie, dass eine Visite im Blutviertel nicht gefährlicher ist als ein Gang durch irgendein Stadtquartier. Trotzdem beunruhigt sie unser Ausflug offensichtlich. Sie wird still und scheint zu frösteln.
Nach fünf Minuten weist sie den Taxifahrer an, die Route in die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen. Wortlos wendet er und navigiert seinen Mercedes durch Schlaglöcher und Schlammpfützen, bis er irgendwo im Westen von Shkodra auf vor uns liegende Häusergruppen zeigt: «Dies ist das Blutviertel.» Hinter hohen Mauern mit Metalltüren sind Hausdächer erkennbar. Die meisten Bauten sind neu, unverputzte Backsteingebäude, nicht älter als zehn Jahre. Während mindestens einer Viertelstunde kurven wir langsam durch die Gassen. Wir treffen auf keine Menschenseele, das Viertel wirkt völlig ausgestorben, gleichwohl habe ich das Gefühl, dass wir beobachtet werden.
Erst bei einem stallähnlichen Haus am Rande der Siedlung erblicken wir einen älteren Mann. Anila ruft ihm etwas zu, und er kommt uns langsam entgegen. Er ist misstrauisch und will offensichtlich nicht, dass wir uns dem Haus nähern. Er gehöre nicht zur Familie, behauptet er, er helfe nur im Garten aus. Auf die Frage, ob es in der Gegend Familien gebe, die in Blutrache lebten, mustert er uns noch misstrauischer, zeigt dann aber auf einige umliegende Häuser. Ja, dort, meint er, und dort, wobei jene zwei Familien das Problem mit Verhandlungen hätten beilegen können. Während wir uns unterhalten, tritt eine Frau vor das Haus des Alten, mustert uns kurz und verschwindet wieder, ohne auf unser Grüssen zu reagieren.
Auf der Rückfahrt über die löchrige Piste wird der Taxifahrer, der bisher kaum ein Wort gesagt hat, gesprächig. Die Regierung habe die Strasse renovieren wollen, erzählt er, aber die Leute hier hätten sich dagegen gewehrt. Aus Gründen der Sicherheit. Eine kaputte Strasse, so deren Überlegung, würde die Schnelligkeit eines potenziellen Angreifers vermindern.
Der Unfall
Wenn die 53-jährige Zojë Delija ihr Häuschen am Stadtrand Shkodras verlässt, prüft sie jedes Gesicht, das ihr entgegenkommt. Lächelt es? Oder ist es traurig, weil eine schlechte Nachricht überbracht werden muss? «Die schlechte Nachricht wäre», sagt die Frau, «dass mein Sohn tot ist. Und diese Nachricht wäre eine Erlösung. Denn ein Leben in einer solchen Anspannung ist kein Leben.»
Vor bald drei Jahren, am 17. Januar 2002, hat ihr Jüngster, Pellumb, 13 Jahre, den 9-jährigen Jungen der Nachbarsfamilie Lulashi erschossen. Es war ein Unfall. Die Kinder hatten mit dem Jagdgewehr gespielt, ein Schuss löste sich und traf den Kleinen in die Brust. Mutter Zojë war ausser sich vor Wut und Verzweiflung. Sie bringe ihren Sohn um, sagte sie der Polizei, nein, sie gebe ihn der anderen Familie, damit diese ihn umbringen kann. Pellumb blieb acht Monate im Gefängnis, bis der Richter in von jeder Schuld freisprach. Pellumb ging direkt zu seinem Vater, der sich mit dem älteren Sohn, zwei Brüdern und deren fünf Söhnen seit dem Todesfall in seinem Heimatdorf versteckt – in Vermosh, einem abgelegenen Bergort nahe bei Montenegro. Alle männlichen Mitglieder der Sippe Delija sind mögliche Ziele der Vergeltung. Das Urteil des staatlichen Gerichts ist ohne Bedeutung.
An der letzten Weihnacht hat Mutter Zojë von ihrem Mann und ihren Söhnen Besuch bekommen. Die Tradition kennt den Begriff Besa, Ehrenwort. Er bedeutet, dass die Blutfehde für eine bestimmte Dauer aufgehoben werden kann: bei Hochzeiten, Ernten, Feiertagen. Der Vater des getöteten Jungen, Ded Lulashi, dessen Haus nur 50 Meter entfernt liegt, gewährte den Delijas fünf Tage. Seit da lebt Mutter Zojë wieder alleine. Die Übersetzerin Anila sagt mir, dass Lulashi den Tod seines Sohnes statt mit Blut auch mit Geld sühnen lassen könnte. In ärmlichen Familien wie diesen würde es sich um ein paar tausend Euro handeln. Aber bis jetzt hat Lulashi keine entsprechenden Signale gegeben.
«Warum», frage ich Zojë, «lässt euch Lula-shi mit seinem Entscheid so lange warten?» «Ich weiss es nicht», antwortet sie, «nur er weiss es.» – «Handelt Lulashi richtig, wenn er Ihren Sohn tötet?» – «Er hat das Recht, es zu tun.» – «Ihr Sohn hat nicht absichtlich etwas Böses getan. Sind Sie nicht wütend auf Lulashi?» – «Ich kann dazu nichts sagen. Nur Gott und Lulashi können über das Leben meines Sohnes entscheiden.» – «Warum gehen Sie nicht rüber zu Lulashi und bitten ihn um Vergebung? Auch Jesus hat vergeben.» – «Das geht nicht. Man muss warten, bis Lulashi sich meldet. Seine Familie ist eine gute Familie. Nie war sie schlecht gegen uns. Wir werden uns seinem Entscheid fügen.»
Der Neunjährige Julian Lumaj hat wenig Erinnerungen an seinen Vater. Vor fünf Jahren klopfte ein Verwandter aus dem bergigen Vermosh an die Türe, überbrachte Grüsse, verteilte Schokolade an die Kinder, zog eine Pistole und streckte Julians Vater mit sieben Schüssen nieder. Es ging um einen Streit um Land, tönt Grossmutter Pashke an. Sie lebt allein mit Julian und seinen beiden jüngeren Geschwistern in einem armseligen Haus am Fluss von Shkodra. Die Mutter der Kinder ist bald nach dem Tod ihres Ehemannes zu einem Mann nach Griechenland gezogen und hat sich nie mehr blicken lassen. «Was willst du einmal werden, wenn du gross bist?», frage ich Julian. Er lächelt schüchtern und zuckt mit den Schultern. «Polizist? Doktor? Chauffeur?» – «Ich weiss es nicht.» – «Wo ist der Mann, der deinen Vater getötet hat?» – «Irgendwo in Belgien.» – «Was soll mit ihm geschehen?» – «Ich werde ihn töten, wenn ich 19 bin.»
Wendige Vermittler
Albaniens Ankunft in der Moderne geschah verspätet und schockartig. Der kommunistische Kasernenstaat hatte sich zwar aufgelöst, aber der neue war schwach und korrupt, und es gab nicht mehr genug traditionelle Vermittler – Älteste und Priester – für verfeindete Familien. Hoxha hatte 60 Prozent des Klerus umbringen lassen, und die Öffnung des Landes führte zu Landflucht, Auswanderung und rasanter Erosion der dörflich-familiären Strukturen. Lebendig geblieben war der düstere Reflex nach Vergeltung, aber wer wusste noch um den feinen Unterschied zwischen Ehre und Verbrechen? Wer hatte die Autorität und die Kompetenz, äusserst komplizierte Fälle zu beurteilen – etwa eine mindestens dreifache Blutrache, bei der ein Autofahrer in ein Fuhrwerk geknallt war und einen Mann, dessen schwangere Frau und das Pferd getötet hatte?
Die Streitigkeiten aus der vorkommunistischen Zeit waren einfacher zu lösen. Sie lagen 50 und mehr Jahre zurück, die Erinnerung an die Ursachen war verblasst, ebenso wie die Emotionen. Für die neuen Fehden, die sich wie eine Plage ausbreiteten, fehlte eine deutende und ordnende Instanz. In das Vakuum stiessen professionelle Mediatoren – Persönlichkeiten mit Einfluss, Hilfsorganisationen, Schwindler. Die Blutrache wurde ein Business.
Wendige Vermittler handelten für viel Geld immer wieder eine neue Besa aus, und als sie eines Tages plötzlich verschwanden, musste die verschuldete Familie feststellen, dass sie einem Betrüger aufgesessen war. Vermeintliche Blutracheopfer nützten das Mitleid karitativer Helfer aus und liessen sich Nahrung, Kleidung und Hausrenovation bezahlen. Nationale Beachtung fanden die Geschäfte eines besonders durchtriebenen Vermittlers. Eine Fernsehdokumentation der BBC über das Phänomen der albanischen Blutrache hatte die Regierung Kanadas bewogen, in einem humanitären Akt eine Anzahl von potenziellen Opfern und deren Familien aufzunehmen. Sie schenkte ihnen Flugtickets und Pässe mit neuen Namen, um die Sicherheit auch in Übersee zu garantieren. Blutrache, dies hatte man gelernt, ist grenzübergreifend. Die rettenden Dokumente wurden dem erwähnten Vermittler übergeben, welcher sie aber nicht an die betreffenden Familien weiterleitete, sondern an andere, gut zahlende. Diesen Sommer wurde er in Shkodra von Unbekannten erschossen.
Leben im Stillstand
In Plejzhe, einem Dorf südlich von Shkodra, besuche ich Ndoc Kapcari, einen sympathischen, etwas gehetzt wirkenden 54-Jährigen. Er behauptet, einer jener Pechvögel zu sein, die um den Pass gebracht worden sind. Seit dreizehn Jahren, sagt er, lebe er in Isolation, «wie ein Gefangener». Damals, 1991, war er wegen einer Lappalie mit einem anderen Mann in Streit geraten. Dieser stach mit einem Messer auf ihn ein, flüchtete auf einem Velo und stürzte so unglücklich, dass er starb. Ndoc schildert jedes Detail des Geschehens, stellt alle Szenen nach und ist aufgewühlt, als sei die Zeit seit da zum Stillstand gekommen.
Das Gericht hielt seine Unschuld fest, aber der Vater des Verstorbenen schwor, den Tod des Sohnes zu vergelten. Die nächsten Jahre verschanzte sich Ndoc in seinem Haus in Shkodra. Dann, 1997, versank das Land im Chaos. Das wirtschaftliche Pyramidensystem war zusammengestürzt, Abertausende Anleger waren ruiniert, und die Leute fielen, von Raserei gepackt, im ganzen Land plündernd und zerstörend über Fabriken, Spitäler, Schulen, Kasernen, Privatliegenschaften her. Auch Ndocs Haus wurde abgebrannt. Er war überzeugt, dass seine Verfolger es angezündet hatten. Er verliess Shkodra und zog nach Plejzhe, wo er ein neues Haus zu bauen begann. Zuerst ein Zimmer, dann eine hohe Umfassungsmauer, dann das nächste Zimmer. Die älteste Tochter verheiratete er mit einem Burschen aus dem Dorf. Als das Paar kurz darauf nach Italien emigrierte, gab er diesem seinen 7-jährigen Sohn mit. Aus Sicherheitsgründen. Wenn fortan eine grössere Geldüberweisung aus Italien eintraf, konnte Ndoc an seinem Haus weiterwerkeln. Noch heute sieht es wie eine Baustelle aus. Die andere Tochter, Ensa, die ein wenig wie die Malerin Frida Kahlo aussieht, blieb bei den Eltern. Sie hatte nur die erste Schulklasse besucht, danach brachte ihr ein Priester zu Hause eine wenigstens elementare Bildung bei. Es soll in der Umgebung Shkodras, erzählte man mir, Hunderte von Kindern geben, die wie Ensa wegen Blutfehden die Schule nicht besuchen.
«Wie viele Male hat die feindliche Familie versucht, dich zu töten?», frage ich Ndoc. «Viele Male», antwortet er und beginnt aufgeregt und etwas wirr von Geschehnissen mit Bewaffneten zu berichten. Er schildert einzelne, beängstigende Szenen, verliert sich in Nebensächlichkeiten, wechselt unvermittelt zu einem anderen Schauplatz, ohne dass eine zusammenhängende Geschichte erkennbar wird. Er redet wie jemand, der unter grossem innerem Druck steht. Nach mehrmaligem Nachfragen schrumpfen die vielen Mordversuche auf drei konkrete Vorfälle: die Rachedrohung des Opfervaters; die Brandstiftung; das Auftauchen von bewaffneten Verwandten des Verstorbenen am Eingangstor, wo sie Ndocs Frau drohten, sie solle im Haus bleiben, ansonsten werde auch sie getötet.
Plötzlich kommt mir das Ganze absurd und lächerlich vor. Da fällt einer dumm vom Rad, worauf sich der andere, der zufällig in der Nähe steht, für die folgenden dreizehn Jahre einschliesst. Er behauptet, in Lebensgefahr zu sein, und begründet seine soziale Einsargung mit drei dubiosen Anekdoten. Dabei hätte der andere in dieser langen Zeit hundert Möglichkeiten gehabt, ihn zu töten, wenn er gewollt hätte. Zudem war mir aufgefallen, dass das Tor zu seinem Hof nur angelehnt war. Ist der Mann ein Lügner? Oder leidet er an einem Verfolgungswahn? Ist er ein psychopathischer Familientyrann? Oder ein Arbeitsscheuer, der sich von karitativen Vereinen durchfüttern lässt? Oder sehe ich die Dinge zu rational?
Selbstmord ist keine Lösung
«Ich verstehe immer noch nicht wirklich», sage ich zu Ndoc, «warum du dich in dein Haus einsperrst.» «Es ist mein Schicksal», antwortet er, «dass ich mit dieser Familie aneinander geriet. Diese Familie ist verrückt.» «Es ist ja nichts wirklich Schlimmes passiert», sage ich. «Komm, ich lade dich ein, lass uns heute nach Shkodra essen gehen.» Er schaut mich an, als hätte er soeben realisiert, dass mit mir etwas nicht stimmt. «Trink», sagt er und schenkt mir vom selbstgebrannten Raki nach, «das tut gut.» «Was ist los mit dem Mann», frage ich Alina auf Deutsch, «ist er normal?» «Er kann das Haus nicht verlassen», sagt sie mit Bestimmtheit. Sie hat denselben ernsten Gesichtsausdruck wie auf dem Weg ins Blutviertel. Sie zweifelt keinen Moment an Ndocs Geschichte. «Der Vater eines Kollegen von mir», fährt sie fort, «befand sich in Blutrache und handelte für die Hochzeit der Tochter eine Besa von fünf Tagen aus. Am sechsten Tag ging er nach draussen, um noch etwas zu erledigen. Eine Stunde später war er tot. Erschossen.»
Nun schaltet sich Ndoc wieder ein. Er redet noch erregter und sprunghafter als vorher. Er berichtet vom Stress, der seine Seele aufgefressen habe, von der Angst, verrückt zu werden, von der Angst, getötet zu werden, jeden Tag, jede Nacht, immer, 24 Stunden lang. Er ruft das Gesetz des Staates und das Gesetz der Berge an und fordert sein Recht ein. Er fühle sich rein und ohne Schuld, aber ein solches Leben, setzt er unheilvoll hinzu, sei es nicht wert, gelebt zu werden. «Oder», deklamiert er, «ist eine Bombe böse, wenn sie explodiert?»
«Warum», frage ich Tochter Ensa, 21, als Ndoc für einen Moment den Raum verlässt, «warum geht dein Vater nicht zu der anderen Familie und besteht auf einem Entscheid? Jede Lösung, sogar wenn sie ihn umbringen würden, scheint mir besser als die jetzige Situation.» «Wenn er getötet würde», sagt Ensa, «müsste sein Bruder wieder töten, was wiederum dessen Familie zerstören würde. Das will Papa nicht.» «Entschuldige die unangebrachte Frage, aber was wäre, wenn dein Vater Selbstmord begehen würde? Wäre dann nicht die ganze Familie frei?» «Nein», antwortet Ensa völlig sachlich, «für Vaters Bruder wäre dies ebenfalls Mord. Und dies hiesse Blut gegen Blut.»
Rächermythos
Am nächsten Tag besuche ich Schwester Maria Christina, eine bayrische Nonne und Angehörige eines winzigen Ordens namens «Spirituelle Weggemeinschaft». Sie lebt seit fünf Jahren in Shkodra und ist engagiert im «Projekt Blutrache», einem von der deutschen Caritas unterstützten Hilfsprogramm. Am Telefon hatte sie wie ein kleines Mädchen geklungen. Ich bin überrascht, eine asketische, ausgemergelte und offensichtlich willensstarke Frau in den Vierzigern anzutreffen. Ich frage sie, was genau ihre Tätigkeit sei, und sie erzählt von «Blutrachegruppen», in denen «peacemaking training» angeboten, «konstruktive Konfliktbewältigungsstrategien» geübt, «Blutrachearbeit» im Dienste der «Gewaltprävention» geleistet würden. Ich mache mich auf eine einschläfernde Pädagogikvorlesung gefasst, als mich die Nonne ein zweites Mal überrascht. Kaum reden wir von konkreten Dingen, verschwindet der Psychojargon. Die Ordensfrau ist eine präzise, erbarmungslose Beobachterin menschlicher Beziehungen.
Ich berichte ihr kurz von meinen Gesprächen mit Zojë, Ndoc und anderen, von deren Fatalismus und von der Unerbittlichkeit der Vergeltung. Die Nonne verweist auf die spezielle Beziehung der Verfeindeten. Die Lage der Eingeschlossenen, ihre Angst und Ungewissheit, meint sie, heizten die Bereitschaft an, den Rächer als allmächtig zu empfinden. Sie erwähnt den Fall von Sef, einem 17-Jährigen, den sie gekannt hat. Der Junge war nach acht Jahren Isolation depressiv geworden, ging zum ersten Mal aus dem Haus und wurde gleich getötet. Solche Geschichten verbreiten sich blitzschnell, und sie füttern den Mythos des allgegenwärtigen Rächers: Er weiss alles, er sieht alles. Und je länger die Isolation dauert – die Nonne kennt eine Familie, die seit sechzehn Jahren eingesperrt lebt –, desto böser und gewaltiger wird er in der Fantasie.
Nach dem Kanun sollte die Vergeltung schnell ausgeführt werden. Aber weil seine genauen Vorschriften nicht mehr allgemein bekannt sind und seine Verbindlichkeit durchlöchert ist, legt sich jeder die Regeln nach seinem Gusto zurecht. So hält der Rächer oder der Blutnehmer, wie die Nonne sagt, den Blutgeber, das potenzielle Opfer, oft hin. Er sagt nicht ja und sagt nicht nein und schiebt die Rache endlos hinaus. Aus Lust am Quälen, ist sie überzeugt, aus Lust an der Macht – eine Versuchung, die allen Menschen innewohnt.
Die Rache ist keine Strafe, sondern soll die Ehre wiederherstellen. Die Ehre beider Familien. Indem sich die Blutgeberfamilie in Isolation begibt, zeigt sie, dass sie den Rächer und dessen Ansprüche respektiert. Ein Blutgeber darf nicht flüchten, dies zeugte von Feigheit und würde das Ansehen der Familie beschmutzen. Er verteidigt sich auch nicht, noch nie hat die Nonne von einem Fall gehört, bei dem das Opfer sich gewehrt hätte. Die kanunisch korrekte Art des Tötens sollte Antlitz zu Antlitz vollzogen werden: Der Rächer ruft das Opfer auf und schiesst ihm zwischen die Augen.
Stein aufs Herz
Die Leute aus der Umgebung der verfeindeten Familien verfolgen das Geschehen genau. Auch sie, sagt die Nonne, weiden sich am Leiden der Eingeschlossenen. Wenn einer der Blutgeber das Haus verlässt, taxieren sie dies als Respektlosigkeit gegenüber dem überlieferten Gesetz. Irgendjemand wird umgehend die feindliche Familie informieren. Die Umgebung macht auch Druck, wenn der Rächer in Vollzugsnotstand gerät. Er wird als Feigling verachtet und bei allen Anlässen geschnitten. Er gilt als wertlos, bis er mit dem Blut des anderen für Sühne gesorgt hat. Diese Mischung aus dunkler Tradition, menschlichen Schwächen und Mitleidlosigkeit stellt die Nonne überall fest. Wenn zum Beispiel eine Frau an der Beerdigung ihres Sohnes oder Verwandten weint, kommt eine andere und drückt ihr einen Stein aufs Herz. Sie darf nicht weinen. Der individuelle Schmerz wird erstickt zugunsten der Erfüllung der kollektiven Ehre.
Ist der Glaube an die Blutrache eine Religion? Er ist ein Kult, sagt die Ordensfrau, etwas Metaphysisches, das sich der Vernunft verweigert, eine Art Götzendienst, ein Erbfluch. Die Leute aus den Bergen glauben, dass die Seele eines Getöteten erst erlöst wird, wenn der Mörder umgebracht worden ist. Wie unter Zwang, wie von Fäden gezogen zieht der Rächer los, bis ans andere Ende der Welt, wenn es sein muss. Selbst aufgeklärte Städter sind nicht gefeit vor diesem atavistischen Automatismus. Die Nonne hat erlebt, wie Akademikerfamilien reflexartig in Isolation abgetaucht sind, nachdem einer der ihren jemanden getötet hatte.
Das Rollenspiel
Es gibt keine offiziellen Statistiken über das Ausmass der Blutrache. Die Behörden wissen nicht einmal, wie viele Einwohner Shkodra hat. 120000, 150000? Ein einheimischer TV-Sender hat neulich von 106 Familien gesprochen, die in Nordalbanien in Blutrache stehen. Die Nonne dagegen schätzt, das allein in Shkodra mindestens 500 verfeindete Sippen leben. Aber niemand weiss Genaues, viele betroffene Familien schweigen, das Thema ist fluchbeladen. Schwester Maria Christina unterstützte beispielsweise zwei Familien mit Geld, Medikamenten, Kleidern, Zuspruch, beide waren wegen Blutfehden in Not geraten. Nach zwei Jahren fand sie zufälligerweise heraus, dass die eine Opferfamilie gleichzeitig die Rächerfamilie der anderen war. Niemand hatte ihr etwas gesagt. Sie stellte die Hilfe sofort ein. Die sind eben schlauer gewesen als ich, meint sie nur.
Sie gibt sich nicht der Illusion hin, dass sie die Leute etwa mit «Blutrachearbeit» vor sich selber retten könnte. In einer seit anderthalb Jahren bestehenden Therapiegruppe zum Thema Konfliktbewältigung für Kinder aus betroffenen Familien führte sie neulich ein Rollenspiel durch: Ein Geldbeutel liegt auf der Strasse, zwei Personen finden ihn. «Wie habt ihr das Problem gelöst?», fragte sie zwei der Mädchen. «Es gab einen Toten», sagte das eine. «Warum?» «Eine Person wurde beim Streit um den Beutel verletzt», erwiderte das andere, «und dies hätte Blutrache bedeutet. Also musste ich sie ganz töten, damit sie es nicht der Sippe weitererzählen konnte.»
An einem Sonntag vor sechs Jahren wurde Francesk Doci, Bauer und Betreiber einer kleinen Milchfabrik, in der Nähe von Shkodra von einem Mann angehalten. Diesem war in der Kirche Francesks Nichte aufgefallen. Er sagte: «Ich will deine Nichte Leonora heiraten.» Francesk antwortete: «Lass uns darüber reden.» Leonora, 17, wohnte in seiner Familie und war im heiratsfähigen Alter. Ab diesem Tag geriet Francesk in ernsthafte Schwierigkeiten.
Es stellte sich heraus, dass der Bewerber zu einer Gruppe Krimineller gehörte, zu einer Gang der Brüder Prroi aus Nicaj-Shale in den Bergen des Nordens, die mit Drogen und Prostitution Geschäfte machte. Als Francesk dies erfuhr, verweigerte er seine Zustimmung zur Heirat, worauf der Bewerber 3000 Euro einforderte. Er hatte Leonora, die von allem nichts wusste, zu diesem Preis bereits an einen Zuhälter in Griechenland verkauft. Francesk verweigerte auch das Geld. Der Bewerber sagte: «Du machst mir Probleme. Ich werde wiederkommen.»
Korrupt
Francesk rief die Polizei an, die sagte, sie könne nichts tun. Er bezahlte einen Polizisten, aber die Gang nahm ihm Waffe und Uniform ab, und Francesk kaufte sich eine alte Kalaschnikow und eine kugelsichere Weste. Einige Monate später wurde er von einem Polizeiauto gestoppt. Ausser dem Polizisten stiegen der Bewerber und zwei seiner Brüder aus. In der folgenden Schiesserei starb einer der Kriminellen. In Francesks Weste blieben vier Kugeln stecken. Verhandlungen mit der Familie des Bewerbers blieben erfolglos. Er schickte den ältesten Sohn in die USA, wo er unter einem anderen Namen lebt, verheiratete zwei Töchter und Leonora in andere Städte, nahm die beiden jüngsten Kinder aus der Schule und engagierte einen Hauslehrer.
Im Juni 2001 war er mit der 11-jährigen Tochter im Auto unterwegs. Er hatte sie aus dem Spital abgeholt. In einer Kurve empfing ihn die Gang mit einem Kugelhagel. Er riss den Wagen herum und raste zurück ins Spital. Neun Kugeln steckten in seinem Körper, drei im Körper der Tochter, das Auto war ein Sieb. Als er an den Infusionsschläuchen hing, erschien ihm die heilige Maria. Dein Mädchen, sagte sie, wird gesund. Und so geschah es. Die Polizei kam ebenfalls ans Bett, und einer der Polizisten zischte ihm zu: «Eine Schande, dass du nicht gestorben bist.» Er war ein Freund des getöteten Gangsters.
Die Prroi-Brüder kamen nach zwei Monaten Gefängnis wieder frei. Diesen September wurden sie wegen Drogenhandel zu lächerlichen fünf Monaten verurteilt. Justiz und Polizei sind käuflich, sagt Francesk, sie schützen die Gangster. Francesk war wohlhabend. Heute ist er ruiniert. Seine Milchfabrik produziert nichts mehr. Die Gang hatte den Chauffeur abgefangen und ihm mitgeteilt, dass niemand mehr dort arbeiten dürfe. Doch Francesk gibt nicht auf.
Nachdem der Gangster gestorben war, schrieb Francesk den Präsidenten an, die Minister, die Richter. Die englische Botschaft, die deutsche, die bulgarische, die italienische, die schwedische. Er hat in acht Fernsehstationen geredet, in albanischen, englischen, deutschen. Drei albanische und über zwanzig ausländische Zeitungen haben über ihn berichtet. Er hat die ganze Welt mobilisiert, und allen hat er dasselbe gesagt: Es gibt keine Sicherheit, niemand hilft mir, niemand schützt mich.
«Francesk, warum bist du so stur? Warum hast du nicht einfach die 3000 Euro bezahlt? Dann hättest du Ruhe gehabt.» «Sie hätten wieder Geld gefordert.» «Woher weisst du das?» «Sie verdienen so ihr Leben. Selbst wenn ich ihnen das Mädchen gegeben hätte, wären sie wiedergekommen. Sie haben auch andere Leute im Dorf erpresst.» «Du hast einen Mann getötet. Seine Familie will Sühne.» «Ich habe niemanden getötet. Gott hat ihn getötet, weil er ein schlechter Mann war.» «Gilt nicht Blut gegen Blut?» «Hätte man es nach dem Kanun gelöst, würde ich getötet, und meine Familie wäre frei. Aber der Kanun gilt hier nicht. Es sind Kriminelle. Sie haben zuerst geschossen.»
Die Witwe des Diktators
Vor meiner Heimreise besuche ich in der Hauptstadt Tirana Nexhmije Hoxha, die Witwe des 1985 verstorbenen Diktators Enver Hoxha. Es ist erstaunlich, dass im Lande der Vendetta nach dem Sturz der roten Tyrannei die Hoxhas am Leben gelassen worden sind. Heute ist Enver Hoxhas Geburtstag, und die gepflegte 84-Jährige spielt Kommunismus. In ihrer bescheidenen Wohnung empfängt sie Delegationen seiner letzten Anhänger – kleine Grüppchen von tatterigem, altersschwachem, demütigem Volk.
Die Witwe lächelt gütig aus dem Polsterstuhl, neben ihr sitzt einer der Söhne, ein Architekt, dem Vater frappant gleichend, nur mit noch weicheren Gesichtszügen. Ich darf ein paar Worte mit der Witwe wechseln. «Madame Hoxha, die Zeiten nach dem Systemwechsel müssen bestimmt schwer für Sie und Ihre Familie gewesen sein.» «Es war nicht leicht. Ich war zwei Jahre im Gefängnis.» Sie lächelt. «Was denken Sie über archaische Bräuche wie die Blutrache?» «Das gab es zu Zeiten meines Mannes nicht. Es herrschte das Gesetz.» «Wie erklären Sie sich eine solche Renaissance?» «Sie wird von dunklen Kräften provoziert.» «An welche denken Sie?» Die Antwort kommt nicht unerwartet. «Die reaktionäre Rechte.» Sie lächelt erneut, überreicht mir ihre 3-bändigen albanischen Memoiren und verabschiedet mich huldvoll.
http://www.weltwoche.ch/artikel/?AssetID=9371&CategoryID=66
Und das sagt heute der Staatspräsident zu dem Thema
Moisiu for All-Sided Commitment Against Blood-Feud
TIRANA - The President of the Republic, Alfred Moisiu called on Tuesday for the state and civil society involvement in the fight against blood-feud during a meeting with the leaders of the Pan-national Reconciliation Committee.President Moisiu thanked the missionaries for their humanitarian mission, for their very good and great work to heal this painful wound of our society
Von Eugen Sorg
Seit dem Zusammenbruch des Kommunismus hat sich in Albanien die Blutrache wie eine Epidemie ausgebreitet. Das archaische Ritual ist Teil des Kanun, eines jahrtausendealten Verhaltenskodex. Der schwache und korrupte Staat ist hilflos. Eine Reportage von Eugen Sorg (Text) und Nathan Beck (Bild)
Streit um Land, oft Anfang der Blutrache: Verwandte von Pjeter Zef Ulaj verstümmelten seine frisch gepflanzten Bäume – er soll verschwinden. (Bild: Nathan Beck)
In Shkodra, der Hauptstadt Nordalbaniens, gibt es ein Quartier mit dem Namen «Blutviertel». Dort leben Familien, die aus Furcht vor Blutrache hergezogen sind – die meisten aus den Dörfern der umliegenden Berge. Blutviertel ist keine offizielle Bezeichnung, und ein Angehöriger der Stadtregierung behauptet, nichts von der Existenz eines solchen Quartiers zu wissen. Alle anderen Leute jedoch, die ich danach frage, wissen sofort, um welchen Stadtteil es sich handelt, und jeder hat auch schon irgendwelche Geschichten darüber gehört. Aber keiner von ihnen war je dort. Es sei nicht ratsam, dorthin zu gehen, meint die Frau an der Rezeption meines Hotels, ohne jedoch genauere Gründe dafür zu nennen. Niemand tue dies, ergänzt ihre Kollegin, als sei dies Erklärung genug. Das stimme, bestätigt später unsere Übersetzerin Anila, eine vife Germanistikstudentin aus Shkodra, sie sei ebenfalls noch nie dort gewesen. Ohnehin, habe ihr ein Freund erzählt, würden am Abend bewaffnete Männer die Zufahrten zum Quartier mit Barrikaden absperren. Anila schluckt kurz, als ich sie auffordere, mich ins Blutviertel zu begleiten, willigt aber ein.
Das Recht der Berge
Unter dem über vier Jahrzehnte herrschenden kommunistischen Regime hatte es keine Blutfehden mehr gegeben. Die Rolle des Bluträchers wurde vom Staat übernommen. Enver Hoxha, der Diktator mit den gepflegten Manieren und dem hübschen, weichen Gesicht, Gründer des ersten atheistischen Staates der Kulturgeschichte, verwandelte Albanien in ein einziges von der Welt abgeschottetes Straflager. Das Trällern eines italienischen Schlagers; ein Schimpfwort über die lausige Qualität des volkseigenen Brotes, den Behörden vom Nachbarn oder Cousin zugetragen; das blosse Androhen von Blutrache – das konnte reichen, damit der Betroffene als «Spion», «ungesundes Element» oder «reaktionärer Schädling» erschossen und dessen gesamte Familie in die Berge deportiert wurde. Das Spitzelwesen war derart durchdringend, dass nicht einmal Liebespaare sich ihre kleinen Geheimnisse zuzuflüstern wagten.
Kaum implodierte der Kommunismus Anfang der neunziger Jahre, wurden wieder Fälle von Blutrache gemeldet. Um die Mitte der neunziger Jahre sassen bereits Hunderte wegen dieses Deliktes in albanischen Gefängnissen. Zum einen waren es generationenalte Abrechnungen, die noch aus präkommunistischen Zeiten stammten, zum anderen waren es neue Fehden. Das Prinzip der Blutrache ist ein Bestandteil des Kanun, des archaischen Gesetzes der Berge, eines 1260 Vorschriften umfassenden Verhaltens- und Ehrenkodex, der über Jahrtausende vom Vater auf den Sohn weitergegeben wurde. Der Kanun überlebte vor allem im schwer zugänglichen katholischen Nordalbanien (und in Teilen des Ko-sovo) die Herrschaft der kulturell überlegenen Römer, Byzantiner, Serben, Türken und offensichtlich auch die gesellschaftliche Folterkammer der Kommunisten. Sein Regelwerk oder vielmehr dessen Geist erwies sich als tief in die kollektive Mentalität eingesenkt, äusserer Beeinflussung kaum zugänglich, als handle es sich um eine neurobiologische Reaktionsmatrix.
Die Übersetzerin Anila hat einige Semester an einer deutschen Uni studiert und verachtet die vormodernen Bräuche eines Teils ihrer Landsleute. Auch für die plötzlich aufgekommene Sitte, kleine Puppen oder Stofftierchen gegen den bösen Blick über den Hauseingängen zu befestigen, findet sie nur spöttische Worte. «Unsinn ist das, dummes, abergläubisches Zeug.» Und im Grunde genommen weiss sie, dass eine Visite im Blutviertel nicht gefährlicher ist als ein Gang durch irgendein Stadtquartier. Trotzdem beunruhigt sie unser Ausflug offensichtlich. Sie wird still und scheint zu frösteln.
Nach fünf Minuten weist sie den Taxifahrer an, die Route in die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen. Wortlos wendet er und navigiert seinen Mercedes durch Schlaglöcher und Schlammpfützen, bis er irgendwo im Westen von Shkodra auf vor uns liegende Häusergruppen zeigt: «Dies ist das Blutviertel.» Hinter hohen Mauern mit Metalltüren sind Hausdächer erkennbar. Die meisten Bauten sind neu, unverputzte Backsteingebäude, nicht älter als zehn Jahre. Während mindestens einer Viertelstunde kurven wir langsam durch die Gassen. Wir treffen auf keine Menschenseele, das Viertel wirkt völlig ausgestorben, gleichwohl habe ich das Gefühl, dass wir beobachtet werden.
Erst bei einem stallähnlichen Haus am Rande der Siedlung erblicken wir einen älteren Mann. Anila ruft ihm etwas zu, und er kommt uns langsam entgegen. Er ist misstrauisch und will offensichtlich nicht, dass wir uns dem Haus nähern. Er gehöre nicht zur Familie, behauptet er, er helfe nur im Garten aus. Auf die Frage, ob es in der Gegend Familien gebe, die in Blutrache lebten, mustert er uns noch misstrauischer, zeigt dann aber auf einige umliegende Häuser. Ja, dort, meint er, und dort, wobei jene zwei Familien das Problem mit Verhandlungen hätten beilegen können. Während wir uns unterhalten, tritt eine Frau vor das Haus des Alten, mustert uns kurz und verschwindet wieder, ohne auf unser Grüssen zu reagieren.
Auf der Rückfahrt über die löchrige Piste wird der Taxifahrer, der bisher kaum ein Wort gesagt hat, gesprächig. Die Regierung habe die Strasse renovieren wollen, erzählt er, aber die Leute hier hätten sich dagegen gewehrt. Aus Gründen der Sicherheit. Eine kaputte Strasse, so deren Überlegung, würde die Schnelligkeit eines potenziellen Angreifers vermindern.
Der Unfall
Wenn die 53-jährige Zojë Delija ihr Häuschen am Stadtrand Shkodras verlässt, prüft sie jedes Gesicht, das ihr entgegenkommt. Lächelt es? Oder ist es traurig, weil eine schlechte Nachricht überbracht werden muss? «Die schlechte Nachricht wäre», sagt die Frau, «dass mein Sohn tot ist. Und diese Nachricht wäre eine Erlösung. Denn ein Leben in einer solchen Anspannung ist kein Leben.»
Vor bald drei Jahren, am 17. Januar 2002, hat ihr Jüngster, Pellumb, 13 Jahre, den 9-jährigen Jungen der Nachbarsfamilie Lulashi erschossen. Es war ein Unfall. Die Kinder hatten mit dem Jagdgewehr gespielt, ein Schuss löste sich und traf den Kleinen in die Brust. Mutter Zojë war ausser sich vor Wut und Verzweiflung. Sie bringe ihren Sohn um, sagte sie der Polizei, nein, sie gebe ihn der anderen Familie, damit diese ihn umbringen kann. Pellumb blieb acht Monate im Gefängnis, bis der Richter in von jeder Schuld freisprach. Pellumb ging direkt zu seinem Vater, der sich mit dem älteren Sohn, zwei Brüdern und deren fünf Söhnen seit dem Todesfall in seinem Heimatdorf versteckt – in Vermosh, einem abgelegenen Bergort nahe bei Montenegro. Alle männlichen Mitglieder der Sippe Delija sind mögliche Ziele der Vergeltung. Das Urteil des staatlichen Gerichts ist ohne Bedeutung.
An der letzten Weihnacht hat Mutter Zojë von ihrem Mann und ihren Söhnen Besuch bekommen. Die Tradition kennt den Begriff Besa, Ehrenwort. Er bedeutet, dass die Blutfehde für eine bestimmte Dauer aufgehoben werden kann: bei Hochzeiten, Ernten, Feiertagen. Der Vater des getöteten Jungen, Ded Lulashi, dessen Haus nur 50 Meter entfernt liegt, gewährte den Delijas fünf Tage. Seit da lebt Mutter Zojë wieder alleine. Die Übersetzerin Anila sagt mir, dass Lulashi den Tod seines Sohnes statt mit Blut auch mit Geld sühnen lassen könnte. In ärmlichen Familien wie diesen würde es sich um ein paar tausend Euro handeln. Aber bis jetzt hat Lulashi keine entsprechenden Signale gegeben.
«Warum», frage ich Zojë, «lässt euch Lula-shi mit seinem Entscheid so lange warten?» «Ich weiss es nicht», antwortet sie, «nur er weiss es.» – «Handelt Lulashi richtig, wenn er Ihren Sohn tötet?» – «Er hat das Recht, es zu tun.» – «Ihr Sohn hat nicht absichtlich etwas Böses getan. Sind Sie nicht wütend auf Lulashi?» – «Ich kann dazu nichts sagen. Nur Gott und Lulashi können über das Leben meines Sohnes entscheiden.» – «Warum gehen Sie nicht rüber zu Lulashi und bitten ihn um Vergebung? Auch Jesus hat vergeben.» – «Das geht nicht. Man muss warten, bis Lulashi sich meldet. Seine Familie ist eine gute Familie. Nie war sie schlecht gegen uns. Wir werden uns seinem Entscheid fügen.»
Der Neunjährige Julian Lumaj hat wenig Erinnerungen an seinen Vater. Vor fünf Jahren klopfte ein Verwandter aus dem bergigen Vermosh an die Türe, überbrachte Grüsse, verteilte Schokolade an die Kinder, zog eine Pistole und streckte Julians Vater mit sieben Schüssen nieder. Es ging um einen Streit um Land, tönt Grossmutter Pashke an. Sie lebt allein mit Julian und seinen beiden jüngeren Geschwistern in einem armseligen Haus am Fluss von Shkodra. Die Mutter der Kinder ist bald nach dem Tod ihres Ehemannes zu einem Mann nach Griechenland gezogen und hat sich nie mehr blicken lassen. «Was willst du einmal werden, wenn du gross bist?», frage ich Julian. Er lächelt schüchtern und zuckt mit den Schultern. «Polizist? Doktor? Chauffeur?» – «Ich weiss es nicht.» – «Wo ist der Mann, der deinen Vater getötet hat?» – «Irgendwo in Belgien.» – «Was soll mit ihm geschehen?» – «Ich werde ihn töten, wenn ich 19 bin.»
Wendige Vermittler
Albaniens Ankunft in der Moderne geschah verspätet und schockartig. Der kommunistische Kasernenstaat hatte sich zwar aufgelöst, aber der neue war schwach und korrupt, und es gab nicht mehr genug traditionelle Vermittler – Älteste und Priester – für verfeindete Familien. Hoxha hatte 60 Prozent des Klerus umbringen lassen, und die Öffnung des Landes führte zu Landflucht, Auswanderung und rasanter Erosion der dörflich-familiären Strukturen. Lebendig geblieben war der düstere Reflex nach Vergeltung, aber wer wusste noch um den feinen Unterschied zwischen Ehre und Verbrechen? Wer hatte die Autorität und die Kompetenz, äusserst komplizierte Fälle zu beurteilen – etwa eine mindestens dreifache Blutrache, bei der ein Autofahrer in ein Fuhrwerk geknallt war und einen Mann, dessen schwangere Frau und das Pferd getötet hatte?
Die Streitigkeiten aus der vorkommunistischen Zeit waren einfacher zu lösen. Sie lagen 50 und mehr Jahre zurück, die Erinnerung an die Ursachen war verblasst, ebenso wie die Emotionen. Für die neuen Fehden, die sich wie eine Plage ausbreiteten, fehlte eine deutende und ordnende Instanz. In das Vakuum stiessen professionelle Mediatoren – Persönlichkeiten mit Einfluss, Hilfsorganisationen, Schwindler. Die Blutrache wurde ein Business.
Wendige Vermittler handelten für viel Geld immer wieder eine neue Besa aus, und als sie eines Tages plötzlich verschwanden, musste die verschuldete Familie feststellen, dass sie einem Betrüger aufgesessen war. Vermeintliche Blutracheopfer nützten das Mitleid karitativer Helfer aus und liessen sich Nahrung, Kleidung und Hausrenovation bezahlen. Nationale Beachtung fanden die Geschäfte eines besonders durchtriebenen Vermittlers. Eine Fernsehdokumentation der BBC über das Phänomen der albanischen Blutrache hatte die Regierung Kanadas bewogen, in einem humanitären Akt eine Anzahl von potenziellen Opfern und deren Familien aufzunehmen. Sie schenkte ihnen Flugtickets und Pässe mit neuen Namen, um die Sicherheit auch in Übersee zu garantieren. Blutrache, dies hatte man gelernt, ist grenzübergreifend. Die rettenden Dokumente wurden dem erwähnten Vermittler übergeben, welcher sie aber nicht an die betreffenden Familien weiterleitete, sondern an andere, gut zahlende. Diesen Sommer wurde er in Shkodra von Unbekannten erschossen.
Leben im Stillstand
In Plejzhe, einem Dorf südlich von Shkodra, besuche ich Ndoc Kapcari, einen sympathischen, etwas gehetzt wirkenden 54-Jährigen. Er behauptet, einer jener Pechvögel zu sein, die um den Pass gebracht worden sind. Seit dreizehn Jahren, sagt er, lebe er in Isolation, «wie ein Gefangener». Damals, 1991, war er wegen einer Lappalie mit einem anderen Mann in Streit geraten. Dieser stach mit einem Messer auf ihn ein, flüchtete auf einem Velo und stürzte so unglücklich, dass er starb. Ndoc schildert jedes Detail des Geschehens, stellt alle Szenen nach und ist aufgewühlt, als sei die Zeit seit da zum Stillstand gekommen.
Das Gericht hielt seine Unschuld fest, aber der Vater des Verstorbenen schwor, den Tod des Sohnes zu vergelten. Die nächsten Jahre verschanzte sich Ndoc in seinem Haus in Shkodra. Dann, 1997, versank das Land im Chaos. Das wirtschaftliche Pyramidensystem war zusammengestürzt, Abertausende Anleger waren ruiniert, und die Leute fielen, von Raserei gepackt, im ganzen Land plündernd und zerstörend über Fabriken, Spitäler, Schulen, Kasernen, Privatliegenschaften her. Auch Ndocs Haus wurde abgebrannt. Er war überzeugt, dass seine Verfolger es angezündet hatten. Er verliess Shkodra und zog nach Plejzhe, wo er ein neues Haus zu bauen begann. Zuerst ein Zimmer, dann eine hohe Umfassungsmauer, dann das nächste Zimmer. Die älteste Tochter verheiratete er mit einem Burschen aus dem Dorf. Als das Paar kurz darauf nach Italien emigrierte, gab er diesem seinen 7-jährigen Sohn mit. Aus Sicherheitsgründen. Wenn fortan eine grössere Geldüberweisung aus Italien eintraf, konnte Ndoc an seinem Haus weiterwerkeln. Noch heute sieht es wie eine Baustelle aus. Die andere Tochter, Ensa, die ein wenig wie die Malerin Frida Kahlo aussieht, blieb bei den Eltern. Sie hatte nur die erste Schulklasse besucht, danach brachte ihr ein Priester zu Hause eine wenigstens elementare Bildung bei. Es soll in der Umgebung Shkodras, erzählte man mir, Hunderte von Kindern geben, die wie Ensa wegen Blutfehden die Schule nicht besuchen.
«Wie viele Male hat die feindliche Familie versucht, dich zu töten?», frage ich Ndoc. «Viele Male», antwortet er und beginnt aufgeregt und etwas wirr von Geschehnissen mit Bewaffneten zu berichten. Er schildert einzelne, beängstigende Szenen, verliert sich in Nebensächlichkeiten, wechselt unvermittelt zu einem anderen Schauplatz, ohne dass eine zusammenhängende Geschichte erkennbar wird. Er redet wie jemand, der unter grossem innerem Druck steht. Nach mehrmaligem Nachfragen schrumpfen die vielen Mordversuche auf drei konkrete Vorfälle: die Rachedrohung des Opfervaters; die Brandstiftung; das Auftauchen von bewaffneten Verwandten des Verstorbenen am Eingangstor, wo sie Ndocs Frau drohten, sie solle im Haus bleiben, ansonsten werde auch sie getötet.
Plötzlich kommt mir das Ganze absurd und lächerlich vor. Da fällt einer dumm vom Rad, worauf sich der andere, der zufällig in der Nähe steht, für die folgenden dreizehn Jahre einschliesst. Er behauptet, in Lebensgefahr zu sein, und begründet seine soziale Einsargung mit drei dubiosen Anekdoten. Dabei hätte der andere in dieser langen Zeit hundert Möglichkeiten gehabt, ihn zu töten, wenn er gewollt hätte. Zudem war mir aufgefallen, dass das Tor zu seinem Hof nur angelehnt war. Ist der Mann ein Lügner? Oder leidet er an einem Verfolgungswahn? Ist er ein psychopathischer Familientyrann? Oder ein Arbeitsscheuer, der sich von karitativen Vereinen durchfüttern lässt? Oder sehe ich die Dinge zu rational?
Selbstmord ist keine Lösung
«Ich verstehe immer noch nicht wirklich», sage ich zu Ndoc, «warum du dich in dein Haus einsperrst.» «Es ist mein Schicksal», antwortet er, «dass ich mit dieser Familie aneinander geriet. Diese Familie ist verrückt.» «Es ist ja nichts wirklich Schlimmes passiert», sage ich. «Komm, ich lade dich ein, lass uns heute nach Shkodra essen gehen.» Er schaut mich an, als hätte er soeben realisiert, dass mit mir etwas nicht stimmt. «Trink», sagt er und schenkt mir vom selbstgebrannten Raki nach, «das tut gut.» «Was ist los mit dem Mann», frage ich Alina auf Deutsch, «ist er normal?» «Er kann das Haus nicht verlassen», sagt sie mit Bestimmtheit. Sie hat denselben ernsten Gesichtsausdruck wie auf dem Weg ins Blutviertel. Sie zweifelt keinen Moment an Ndocs Geschichte. «Der Vater eines Kollegen von mir», fährt sie fort, «befand sich in Blutrache und handelte für die Hochzeit der Tochter eine Besa von fünf Tagen aus. Am sechsten Tag ging er nach draussen, um noch etwas zu erledigen. Eine Stunde später war er tot. Erschossen.»
Nun schaltet sich Ndoc wieder ein. Er redet noch erregter und sprunghafter als vorher. Er berichtet vom Stress, der seine Seele aufgefressen habe, von der Angst, verrückt zu werden, von der Angst, getötet zu werden, jeden Tag, jede Nacht, immer, 24 Stunden lang. Er ruft das Gesetz des Staates und das Gesetz der Berge an und fordert sein Recht ein. Er fühle sich rein und ohne Schuld, aber ein solches Leben, setzt er unheilvoll hinzu, sei es nicht wert, gelebt zu werden. «Oder», deklamiert er, «ist eine Bombe böse, wenn sie explodiert?»
«Warum», frage ich Tochter Ensa, 21, als Ndoc für einen Moment den Raum verlässt, «warum geht dein Vater nicht zu der anderen Familie und besteht auf einem Entscheid? Jede Lösung, sogar wenn sie ihn umbringen würden, scheint mir besser als die jetzige Situation.» «Wenn er getötet würde», sagt Ensa, «müsste sein Bruder wieder töten, was wiederum dessen Familie zerstören würde. Das will Papa nicht.» «Entschuldige die unangebrachte Frage, aber was wäre, wenn dein Vater Selbstmord begehen würde? Wäre dann nicht die ganze Familie frei?» «Nein», antwortet Ensa völlig sachlich, «für Vaters Bruder wäre dies ebenfalls Mord. Und dies hiesse Blut gegen Blut.»
Rächermythos
Am nächsten Tag besuche ich Schwester Maria Christina, eine bayrische Nonne und Angehörige eines winzigen Ordens namens «Spirituelle Weggemeinschaft». Sie lebt seit fünf Jahren in Shkodra und ist engagiert im «Projekt Blutrache», einem von der deutschen Caritas unterstützten Hilfsprogramm. Am Telefon hatte sie wie ein kleines Mädchen geklungen. Ich bin überrascht, eine asketische, ausgemergelte und offensichtlich willensstarke Frau in den Vierzigern anzutreffen. Ich frage sie, was genau ihre Tätigkeit sei, und sie erzählt von «Blutrachegruppen», in denen «peacemaking training» angeboten, «konstruktive Konfliktbewältigungsstrategien» geübt, «Blutrachearbeit» im Dienste der «Gewaltprävention» geleistet würden. Ich mache mich auf eine einschläfernde Pädagogikvorlesung gefasst, als mich die Nonne ein zweites Mal überrascht. Kaum reden wir von konkreten Dingen, verschwindet der Psychojargon. Die Ordensfrau ist eine präzise, erbarmungslose Beobachterin menschlicher Beziehungen.
Ich berichte ihr kurz von meinen Gesprächen mit Zojë, Ndoc und anderen, von deren Fatalismus und von der Unerbittlichkeit der Vergeltung. Die Nonne verweist auf die spezielle Beziehung der Verfeindeten. Die Lage der Eingeschlossenen, ihre Angst und Ungewissheit, meint sie, heizten die Bereitschaft an, den Rächer als allmächtig zu empfinden. Sie erwähnt den Fall von Sef, einem 17-Jährigen, den sie gekannt hat. Der Junge war nach acht Jahren Isolation depressiv geworden, ging zum ersten Mal aus dem Haus und wurde gleich getötet. Solche Geschichten verbreiten sich blitzschnell, und sie füttern den Mythos des allgegenwärtigen Rächers: Er weiss alles, er sieht alles. Und je länger die Isolation dauert – die Nonne kennt eine Familie, die seit sechzehn Jahren eingesperrt lebt –, desto böser und gewaltiger wird er in der Fantasie.
Nach dem Kanun sollte die Vergeltung schnell ausgeführt werden. Aber weil seine genauen Vorschriften nicht mehr allgemein bekannt sind und seine Verbindlichkeit durchlöchert ist, legt sich jeder die Regeln nach seinem Gusto zurecht. So hält der Rächer oder der Blutnehmer, wie die Nonne sagt, den Blutgeber, das potenzielle Opfer, oft hin. Er sagt nicht ja und sagt nicht nein und schiebt die Rache endlos hinaus. Aus Lust am Quälen, ist sie überzeugt, aus Lust an der Macht – eine Versuchung, die allen Menschen innewohnt.
Die Rache ist keine Strafe, sondern soll die Ehre wiederherstellen. Die Ehre beider Familien. Indem sich die Blutgeberfamilie in Isolation begibt, zeigt sie, dass sie den Rächer und dessen Ansprüche respektiert. Ein Blutgeber darf nicht flüchten, dies zeugte von Feigheit und würde das Ansehen der Familie beschmutzen. Er verteidigt sich auch nicht, noch nie hat die Nonne von einem Fall gehört, bei dem das Opfer sich gewehrt hätte. Die kanunisch korrekte Art des Tötens sollte Antlitz zu Antlitz vollzogen werden: Der Rächer ruft das Opfer auf und schiesst ihm zwischen die Augen.
Stein aufs Herz
Die Leute aus der Umgebung der verfeindeten Familien verfolgen das Geschehen genau. Auch sie, sagt die Nonne, weiden sich am Leiden der Eingeschlossenen. Wenn einer der Blutgeber das Haus verlässt, taxieren sie dies als Respektlosigkeit gegenüber dem überlieferten Gesetz. Irgendjemand wird umgehend die feindliche Familie informieren. Die Umgebung macht auch Druck, wenn der Rächer in Vollzugsnotstand gerät. Er wird als Feigling verachtet und bei allen Anlässen geschnitten. Er gilt als wertlos, bis er mit dem Blut des anderen für Sühne gesorgt hat. Diese Mischung aus dunkler Tradition, menschlichen Schwächen und Mitleidlosigkeit stellt die Nonne überall fest. Wenn zum Beispiel eine Frau an der Beerdigung ihres Sohnes oder Verwandten weint, kommt eine andere und drückt ihr einen Stein aufs Herz. Sie darf nicht weinen. Der individuelle Schmerz wird erstickt zugunsten der Erfüllung der kollektiven Ehre.
Ist der Glaube an die Blutrache eine Religion? Er ist ein Kult, sagt die Ordensfrau, etwas Metaphysisches, das sich der Vernunft verweigert, eine Art Götzendienst, ein Erbfluch. Die Leute aus den Bergen glauben, dass die Seele eines Getöteten erst erlöst wird, wenn der Mörder umgebracht worden ist. Wie unter Zwang, wie von Fäden gezogen zieht der Rächer los, bis ans andere Ende der Welt, wenn es sein muss. Selbst aufgeklärte Städter sind nicht gefeit vor diesem atavistischen Automatismus. Die Nonne hat erlebt, wie Akademikerfamilien reflexartig in Isolation abgetaucht sind, nachdem einer der ihren jemanden getötet hatte.
Das Rollenspiel
Es gibt keine offiziellen Statistiken über das Ausmass der Blutrache. Die Behörden wissen nicht einmal, wie viele Einwohner Shkodra hat. 120000, 150000? Ein einheimischer TV-Sender hat neulich von 106 Familien gesprochen, die in Nordalbanien in Blutrache stehen. Die Nonne dagegen schätzt, das allein in Shkodra mindestens 500 verfeindete Sippen leben. Aber niemand weiss Genaues, viele betroffene Familien schweigen, das Thema ist fluchbeladen. Schwester Maria Christina unterstützte beispielsweise zwei Familien mit Geld, Medikamenten, Kleidern, Zuspruch, beide waren wegen Blutfehden in Not geraten. Nach zwei Jahren fand sie zufälligerweise heraus, dass die eine Opferfamilie gleichzeitig die Rächerfamilie der anderen war. Niemand hatte ihr etwas gesagt. Sie stellte die Hilfe sofort ein. Die sind eben schlauer gewesen als ich, meint sie nur.
Sie gibt sich nicht der Illusion hin, dass sie die Leute etwa mit «Blutrachearbeit» vor sich selber retten könnte. In einer seit anderthalb Jahren bestehenden Therapiegruppe zum Thema Konfliktbewältigung für Kinder aus betroffenen Familien führte sie neulich ein Rollenspiel durch: Ein Geldbeutel liegt auf der Strasse, zwei Personen finden ihn. «Wie habt ihr das Problem gelöst?», fragte sie zwei der Mädchen. «Es gab einen Toten», sagte das eine. «Warum?» «Eine Person wurde beim Streit um den Beutel verletzt», erwiderte das andere, «und dies hätte Blutrache bedeutet. Also musste ich sie ganz töten, damit sie es nicht der Sippe weitererzählen konnte.»
An einem Sonntag vor sechs Jahren wurde Francesk Doci, Bauer und Betreiber einer kleinen Milchfabrik, in der Nähe von Shkodra von einem Mann angehalten. Diesem war in der Kirche Francesks Nichte aufgefallen. Er sagte: «Ich will deine Nichte Leonora heiraten.» Francesk antwortete: «Lass uns darüber reden.» Leonora, 17, wohnte in seiner Familie und war im heiratsfähigen Alter. Ab diesem Tag geriet Francesk in ernsthafte Schwierigkeiten.
Es stellte sich heraus, dass der Bewerber zu einer Gruppe Krimineller gehörte, zu einer Gang der Brüder Prroi aus Nicaj-Shale in den Bergen des Nordens, die mit Drogen und Prostitution Geschäfte machte. Als Francesk dies erfuhr, verweigerte er seine Zustimmung zur Heirat, worauf der Bewerber 3000 Euro einforderte. Er hatte Leonora, die von allem nichts wusste, zu diesem Preis bereits an einen Zuhälter in Griechenland verkauft. Francesk verweigerte auch das Geld. Der Bewerber sagte: «Du machst mir Probleme. Ich werde wiederkommen.»
Korrupt
Francesk rief die Polizei an, die sagte, sie könne nichts tun. Er bezahlte einen Polizisten, aber die Gang nahm ihm Waffe und Uniform ab, und Francesk kaufte sich eine alte Kalaschnikow und eine kugelsichere Weste. Einige Monate später wurde er von einem Polizeiauto gestoppt. Ausser dem Polizisten stiegen der Bewerber und zwei seiner Brüder aus. In der folgenden Schiesserei starb einer der Kriminellen. In Francesks Weste blieben vier Kugeln stecken. Verhandlungen mit der Familie des Bewerbers blieben erfolglos. Er schickte den ältesten Sohn in die USA, wo er unter einem anderen Namen lebt, verheiratete zwei Töchter und Leonora in andere Städte, nahm die beiden jüngsten Kinder aus der Schule und engagierte einen Hauslehrer.
Im Juni 2001 war er mit der 11-jährigen Tochter im Auto unterwegs. Er hatte sie aus dem Spital abgeholt. In einer Kurve empfing ihn die Gang mit einem Kugelhagel. Er riss den Wagen herum und raste zurück ins Spital. Neun Kugeln steckten in seinem Körper, drei im Körper der Tochter, das Auto war ein Sieb. Als er an den Infusionsschläuchen hing, erschien ihm die heilige Maria. Dein Mädchen, sagte sie, wird gesund. Und so geschah es. Die Polizei kam ebenfalls ans Bett, und einer der Polizisten zischte ihm zu: «Eine Schande, dass du nicht gestorben bist.» Er war ein Freund des getöteten Gangsters.
Die Prroi-Brüder kamen nach zwei Monaten Gefängnis wieder frei. Diesen September wurden sie wegen Drogenhandel zu lächerlichen fünf Monaten verurteilt. Justiz und Polizei sind käuflich, sagt Francesk, sie schützen die Gangster. Francesk war wohlhabend. Heute ist er ruiniert. Seine Milchfabrik produziert nichts mehr. Die Gang hatte den Chauffeur abgefangen und ihm mitgeteilt, dass niemand mehr dort arbeiten dürfe. Doch Francesk gibt nicht auf.
Nachdem der Gangster gestorben war, schrieb Francesk den Präsidenten an, die Minister, die Richter. Die englische Botschaft, die deutsche, die bulgarische, die italienische, die schwedische. Er hat in acht Fernsehstationen geredet, in albanischen, englischen, deutschen. Drei albanische und über zwanzig ausländische Zeitungen haben über ihn berichtet. Er hat die ganze Welt mobilisiert, und allen hat er dasselbe gesagt: Es gibt keine Sicherheit, niemand hilft mir, niemand schützt mich.
«Francesk, warum bist du so stur? Warum hast du nicht einfach die 3000 Euro bezahlt? Dann hättest du Ruhe gehabt.» «Sie hätten wieder Geld gefordert.» «Woher weisst du das?» «Sie verdienen so ihr Leben. Selbst wenn ich ihnen das Mädchen gegeben hätte, wären sie wiedergekommen. Sie haben auch andere Leute im Dorf erpresst.» «Du hast einen Mann getötet. Seine Familie will Sühne.» «Ich habe niemanden getötet. Gott hat ihn getötet, weil er ein schlechter Mann war.» «Gilt nicht Blut gegen Blut?» «Hätte man es nach dem Kanun gelöst, würde ich getötet, und meine Familie wäre frei. Aber der Kanun gilt hier nicht. Es sind Kriminelle. Sie haben zuerst geschossen.»
Die Witwe des Diktators
Vor meiner Heimreise besuche ich in der Hauptstadt Tirana Nexhmije Hoxha, die Witwe des 1985 verstorbenen Diktators Enver Hoxha. Es ist erstaunlich, dass im Lande der Vendetta nach dem Sturz der roten Tyrannei die Hoxhas am Leben gelassen worden sind. Heute ist Enver Hoxhas Geburtstag, und die gepflegte 84-Jährige spielt Kommunismus. In ihrer bescheidenen Wohnung empfängt sie Delegationen seiner letzten Anhänger – kleine Grüppchen von tatterigem, altersschwachem, demütigem Volk.
Die Witwe lächelt gütig aus dem Polsterstuhl, neben ihr sitzt einer der Söhne, ein Architekt, dem Vater frappant gleichend, nur mit noch weicheren Gesichtszügen. Ich darf ein paar Worte mit der Witwe wechseln. «Madame Hoxha, die Zeiten nach dem Systemwechsel müssen bestimmt schwer für Sie und Ihre Familie gewesen sein.» «Es war nicht leicht. Ich war zwei Jahre im Gefängnis.» Sie lächelt. «Was denken Sie über archaische Bräuche wie die Blutrache?» «Das gab es zu Zeiten meines Mannes nicht. Es herrschte das Gesetz.» «Wie erklären Sie sich eine solche Renaissance?» «Sie wird von dunklen Kräften provoziert.» «An welche denken Sie?» Die Antwort kommt nicht unerwartet. «Die reaktionäre Rechte.» Sie lächelt erneut, überreicht mir ihre 3-bändigen albanischen Memoiren und verabschiedet mich huldvoll.
http://www.weltwoche.ch/artikel/?AssetID=9371&CategoryID=66
Und das sagt heute der Staatspräsident zu dem Thema
Moisiu for All-Sided Commitment Against Blood-Feud
TIRANA - The President of the Republic, Alfred Moisiu called on Tuesday for the state and civil society involvement in the fight against blood-feud during a meeting with the leaders of the Pan-national Reconciliation Committee.President Moisiu thanked the missionaries for their humanitarian mission, for their very good and great work to heal this painful wound of our society