BitterSweet
Top-Poster
Heiliger Berg Athos
Der Heilige Berg Athos (griech. Άγιον Όρος, Hágion Óros, der Heilige Berg) ist eine orthodoxe Mönchsrepublik mit autonomem Status unter griechischer Souveränität. Der Berg Athos liegt auf dem östlichen Finger der Halbinsel Chalkidiki in der Verwaltungsregion Zentralmakedonien und bildet mit 2.033 m Höhe die höchste Erhebung an der Südspitze der Chalkidiki-Halbinsel. Das Territorium umfasst 336 km² und zählt rund 2000 (mönchische) Einwohner.
Weltkulturerbe
Die 20 Großklöster der orthodoxen Mönchsrepublik sind Teil des UNESCO-Welterbes. Das erste Kloster, die Große Lavra, wurde 963 von byzantinischen Mönchen gegründet. Bald gründeten bulgarische, rumänische, russische und serbische Mönche weitere Großklöster auf dem Berg Athos. Davon sind heute 17 griechisch, je eines russisch, bulgarisch und serbisch.
Neben den Klöstern gibt es auf dem Athos die Siedlungsform der Skiten (gr. σκήτες), die jeweils von ihrem Gründungsklöster abhängen, somit keine eigenständigen Rechte in Regierung und Verwaltung der Mönchsrepublik besitzen. Skiten, rund um einen klösterlichen Zentralbau angelegt, der in Gebäuden und Funktionen den größeren Klöstern gleicht, sind dörfliche Siedlungen, deren Bauten in Kalivia (gr. καλύβια, eigentlich: Hütten), Wohnbauten für mehrere Mönche, und Kellia (gr. κελλιá, eigentlich: Zellen), Hütten für einen Bewohner, unterschieden werden. Außerdem siedeln an den schwer zugänglichen Hängen des eigentlichen Berges Athos Mönche in Eremitagen (gr. εσυχαστήρια, Hesychasterien), zumeist Kleinstbauten und Höhlen.
Berühmt sind die Malerwerkstätten des Athos, deren große Tradition der Ikonenmalerei ins Hochmittelalter zurückreicht, als Maler-Mönche der sog. Makedonischen Schule von Thessaloniki auf den Athos umsiedelten.
Lebensform
Waren die meisten Klöster früher idiorrhythmisch organisiert, sind seit 1980 auch die letzten Klöster wieder zum koinobitischem Lebensstil zurückgekehrt.
Die Klöster folgen weiterhin dem julianischen Kalender, der dem ab 1582 in Westeuropa eingeführten gregorianischen Kalender mittlerweile um 13 Tage „hinterher hinkt“. Die Stundeneinteilung orientiert sich ebenfalls am byzantinischen Beispiel: Der Tag beginnt also mit Sonnenuntergang (Null Uhr); allein das Kloster von Iviron zählt die Stunden ab Sonnenaufgang.
Pilgerreisen
Auf dem Berg war die Fortbewegung lange Zeit über weite Strecken nur zu Fuß möglich. Im Jahr 1963 wurde zur 1000-Jahrfeier die erste Schotterstraße zwischen Dafni (Hafen von Athos, den man per Schiffsverbindung von Ouranópolis aus erreicht) und der Hauptstadt Karyes gebaut. Inzwischen sind die meisten Klöster über Schotterpisten mit dem Hauptort Karyes verbunden. Über diese Pisten werden die Klöster mit Bussen angefahren. Die Klöster, die nicht ans Straßennetz angebunden sind, sind auf jeden Fall per Schiff erreichbar. Die Halbinsel ist für (männliche) Pilger, jedoch nicht für klassische Touristen zugänglich. Wenn man gewisse Regeln einhält, wird man problemlos als „Pilger“ anerkannt. Über die Homepage des deutschen Konsulats in Thessaloniki ist ein stets aktuelles Merkblatt zum Besuch der Mönchrepublik abrufbar.
Frauen ist der Zutritt zum Berg Athos untersagt, was wiederholt zu Kontroversen mit der Europäischen Union geführt hat. Selbst weibliche Tiere sind von dem Verbot betroffen, allerdings gibt es eine Ausnahme – für Mönche, die Ikonen malen. Diese benötigen für ihre Arbeit frischen Eidotter, somit dürfen sie als einzige Hühner halten. Außerdem sind Katzen erlaubt, denn Mäuse halten sich auch nicht an das Verbot.
Verwaltung
Die Mönchsrepublik gehört völkerrechtlich zu Griechenland (in alter Staatsrechtterminologie: ist souzerän), durch den autonomen Status obliegen einige innenpolitische Entscheidungen und die Verwaltung des Berges aber den Mönchen, ebenso gehört der Berg Athos nicht zum steuerlichen Gemeinschaftsgebiet der EU. Jedes Kloster ist innerhalb der Mönchsrepublik autonom und wird von einem auf Lebenszeit gewählten Abt geleitet. Die Macht liegt bei den 20 Großklöstern, von denen Kleinklöster (Metóchia), Mönchsdörfer (Skiten) und Einsiedeleien (Kellia) abhängen.
In dem kleinen Hauptort Karyes befindet sich die Kirche des Protaton sowie das Gebäude der Hiera Synaxis („Heilige Versammlung“), die aus den Äbten der 20 Klöster besteht und legislative und judikative Funktionen wahrnimmt. In Karyes gibt es 19 Kellia („Zellen“), in denen die Äbte untergebracht sind. Eine Ausnahme hierzu bildet das Kloster Koutloumousiou, da es in der Nähe von Karyes angesiedelt ist und demzufolge eine eigene Zelle nicht benötigt. Karyes ist der Sitz der Hiera Koinotis („Heilige Zusammenkunft“), also des „Parlaments“, in das jedes Großkloster einen Vertreter (Antiprosopos) entsendet. Der Protos („der Erste“), der jährlich neugewählte Vorsitzende der Exekutive, hat seinen Sitz ebenfalls dort.
Der staatliche Gouverneur Griechenlands auf dem Athos untersteht dem griechischen Außenministerium und ist zusammen mit einigen Beamten und Polizisten für die Einhaltung der Verfassung des Athos und die Wahrung von Sicherheit und Ordnung zuständig.
Interne Konflikte
Für internationale Schlagzeilen sorgte im Dezember 2005 die Besetzung des Konaki (Sitz des Vorstandes der Mönchsrepublik) durch 20 Mönche des Klosters Esfigménou. Damit protestierten sie gegen den Beschluss der übrigen 19 Klöster, die Vertretung ihres Klosters in den Gremien der Mönchsrepublik nicht mehr anzuerkennen. Ausgelöst wurde der Eklat nach jahrzehntelang schwelender Krise 2003, als die Mönche von Esfigménou dem Oberhaupt der orthodoxen Kirche, Patriarch Bartholomäus I. von Konstantinopel „Verrat an der Orthodoxie“ vorwarfen, weil er mit der römisch-katholischen Kirche Gespräche aufgenommen hatte. Daraufhin hatte der Patriarch die Rebellen zum Verlassen der Mönchsrepublik aufgefordert. Die Mönche von Esfigménou ignorierten die Forderung und harren weiter in ihrem Kloster aus.
Der Klosterbrand vom 3./4. März 2004
Bei einem Feuer in der Nacht vom 3. zum 4. März 2004 im serbischen Kloster Chiliandarí (serb. Hilandar) wurden wertvolle Wandmalereien aus dem 12. und 13. Jahrhundert ein Raub der Flammen. Viele wertvolle Ikonen, Handschriften und auch Fresken konnten zwar gerettet werden, doch allein der materielle Schaden wird auf bis über 20 Millionen Euro geschätzt. Die Mönche mussten die zur Hälfte zerstörte Klosteranlage verlassen. Serbiens Präsident Vojislav Koštunica hat in seinem Land einen Spendenaufruf zur Wiederherstellung des Klosters getätigt, aber auch die serbisch-orthodoxe Kirche sammelt Mittel zur Restaurierung.





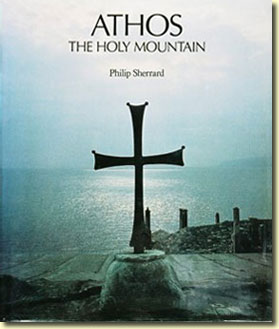





%20-%20James%20L.%20Stanfield.jpg_thumb.jpg)




Der Heilige Berg Athos (griech. Άγιον Όρος, Hágion Óros, der Heilige Berg) ist eine orthodoxe Mönchsrepublik mit autonomem Status unter griechischer Souveränität. Der Berg Athos liegt auf dem östlichen Finger der Halbinsel Chalkidiki in der Verwaltungsregion Zentralmakedonien und bildet mit 2.033 m Höhe die höchste Erhebung an der Südspitze der Chalkidiki-Halbinsel. Das Territorium umfasst 336 km² und zählt rund 2000 (mönchische) Einwohner.
Weltkulturerbe
Die 20 Großklöster der orthodoxen Mönchsrepublik sind Teil des UNESCO-Welterbes. Das erste Kloster, die Große Lavra, wurde 963 von byzantinischen Mönchen gegründet. Bald gründeten bulgarische, rumänische, russische und serbische Mönche weitere Großklöster auf dem Berg Athos. Davon sind heute 17 griechisch, je eines russisch, bulgarisch und serbisch.
Neben den Klöstern gibt es auf dem Athos die Siedlungsform der Skiten (gr. σκήτες), die jeweils von ihrem Gründungsklöster abhängen, somit keine eigenständigen Rechte in Regierung und Verwaltung der Mönchsrepublik besitzen. Skiten, rund um einen klösterlichen Zentralbau angelegt, der in Gebäuden und Funktionen den größeren Klöstern gleicht, sind dörfliche Siedlungen, deren Bauten in Kalivia (gr. καλύβια, eigentlich: Hütten), Wohnbauten für mehrere Mönche, und Kellia (gr. κελλιá, eigentlich: Zellen), Hütten für einen Bewohner, unterschieden werden. Außerdem siedeln an den schwer zugänglichen Hängen des eigentlichen Berges Athos Mönche in Eremitagen (gr. εσυχαστήρια, Hesychasterien), zumeist Kleinstbauten und Höhlen.
Berühmt sind die Malerwerkstätten des Athos, deren große Tradition der Ikonenmalerei ins Hochmittelalter zurückreicht, als Maler-Mönche der sog. Makedonischen Schule von Thessaloniki auf den Athos umsiedelten.
Lebensform
Waren die meisten Klöster früher idiorrhythmisch organisiert, sind seit 1980 auch die letzten Klöster wieder zum koinobitischem Lebensstil zurückgekehrt.
Die Klöster folgen weiterhin dem julianischen Kalender, der dem ab 1582 in Westeuropa eingeführten gregorianischen Kalender mittlerweile um 13 Tage „hinterher hinkt“. Die Stundeneinteilung orientiert sich ebenfalls am byzantinischen Beispiel: Der Tag beginnt also mit Sonnenuntergang (Null Uhr); allein das Kloster von Iviron zählt die Stunden ab Sonnenaufgang.
Pilgerreisen
Auf dem Berg war die Fortbewegung lange Zeit über weite Strecken nur zu Fuß möglich. Im Jahr 1963 wurde zur 1000-Jahrfeier die erste Schotterstraße zwischen Dafni (Hafen von Athos, den man per Schiffsverbindung von Ouranópolis aus erreicht) und der Hauptstadt Karyes gebaut. Inzwischen sind die meisten Klöster über Schotterpisten mit dem Hauptort Karyes verbunden. Über diese Pisten werden die Klöster mit Bussen angefahren. Die Klöster, die nicht ans Straßennetz angebunden sind, sind auf jeden Fall per Schiff erreichbar. Die Halbinsel ist für (männliche) Pilger, jedoch nicht für klassische Touristen zugänglich. Wenn man gewisse Regeln einhält, wird man problemlos als „Pilger“ anerkannt. Über die Homepage des deutschen Konsulats in Thessaloniki ist ein stets aktuelles Merkblatt zum Besuch der Mönchrepublik abrufbar.
Frauen ist der Zutritt zum Berg Athos untersagt, was wiederholt zu Kontroversen mit der Europäischen Union geführt hat. Selbst weibliche Tiere sind von dem Verbot betroffen, allerdings gibt es eine Ausnahme – für Mönche, die Ikonen malen. Diese benötigen für ihre Arbeit frischen Eidotter, somit dürfen sie als einzige Hühner halten. Außerdem sind Katzen erlaubt, denn Mäuse halten sich auch nicht an das Verbot.
Verwaltung
Die Mönchsrepublik gehört völkerrechtlich zu Griechenland (in alter Staatsrechtterminologie: ist souzerän), durch den autonomen Status obliegen einige innenpolitische Entscheidungen und die Verwaltung des Berges aber den Mönchen, ebenso gehört der Berg Athos nicht zum steuerlichen Gemeinschaftsgebiet der EU. Jedes Kloster ist innerhalb der Mönchsrepublik autonom und wird von einem auf Lebenszeit gewählten Abt geleitet. Die Macht liegt bei den 20 Großklöstern, von denen Kleinklöster (Metóchia), Mönchsdörfer (Skiten) und Einsiedeleien (Kellia) abhängen.
In dem kleinen Hauptort Karyes befindet sich die Kirche des Protaton sowie das Gebäude der Hiera Synaxis („Heilige Versammlung“), die aus den Äbten der 20 Klöster besteht und legislative und judikative Funktionen wahrnimmt. In Karyes gibt es 19 Kellia („Zellen“), in denen die Äbte untergebracht sind. Eine Ausnahme hierzu bildet das Kloster Koutloumousiou, da es in der Nähe von Karyes angesiedelt ist und demzufolge eine eigene Zelle nicht benötigt. Karyes ist der Sitz der Hiera Koinotis („Heilige Zusammenkunft“), also des „Parlaments“, in das jedes Großkloster einen Vertreter (Antiprosopos) entsendet. Der Protos („der Erste“), der jährlich neugewählte Vorsitzende der Exekutive, hat seinen Sitz ebenfalls dort.
Der staatliche Gouverneur Griechenlands auf dem Athos untersteht dem griechischen Außenministerium und ist zusammen mit einigen Beamten und Polizisten für die Einhaltung der Verfassung des Athos und die Wahrung von Sicherheit und Ordnung zuständig.
Interne Konflikte
Für internationale Schlagzeilen sorgte im Dezember 2005 die Besetzung des Konaki (Sitz des Vorstandes der Mönchsrepublik) durch 20 Mönche des Klosters Esfigménou. Damit protestierten sie gegen den Beschluss der übrigen 19 Klöster, die Vertretung ihres Klosters in den Gremien der Mönchsrepublik nicht mehr anzuerkennen. Ausgelöst wurde der Eklat nach jahrzehntelang schwelender Krise 2003, als die Mönche von Esfigménou dem Oberhaupt der orthodoxen Kirche, Patriarch Bartholomäus I. von Konstantinopel „Verrat an der Orthodoxie“ vorwarfen, weil er mit der römisch-katholischen Kirche Gespräche aufgenommen hatte. Daraufhin hatte der Patriarch die Rebellen zum Verlassen der Mönchsrepublik aufgefordert. Die Mönche von Esfigménou ignorierten die Forderung und harren weiter in ihrem Kloster aus.
Der Klosterbrand vom 3./4. März 2004
Bei einem Feuer in der Nacht vom 3. zum 4. März 2004 im serbischen Kloster Chiliandarí (serb. Hilandar) wurden wertvolle Wandmalereien aus dem 12. und 13. Jahrhundert ein Raub der Flammen. Viele wertvolle Ikonen, Handschriften und auch Fresken konnten zwar gerettet werden, doch allein der materielle Schaden wird auf bis über 20 Millionen Euro geschätzt. Die Mönche mussten die zur Hälfte zerstörte Klosteranlage verlassen. Serbiens Präsident Vojislav Koštunica hat in seinem Land einen Spendenaufruf zur Wiederherstellung des Klosters getätigt, aber auch die serbisch-orthodoxe Kirche sammelt Mittel zur Restaurierung.




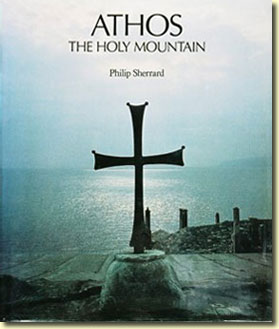





%20-%20James%20L.%20Stanfield.jpg_thumb.jpg)



