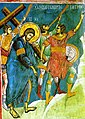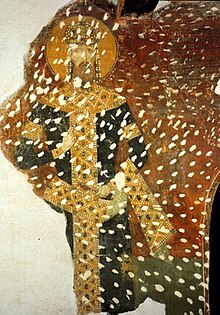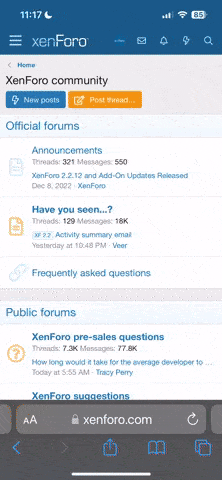Albion der Name
Metohija ist älter als der albanische Name Dukagjin bzw früher hies es auf serbisch noch anders. Du hättest zumindest beides hinschreiben können wie ich weiss ist serbisch in ganz Kosovo Amtssprache neben albanisch.
Aus Wiki...
Metochien


Metochien innerhalb des Kosovo


Karte des Kosovo
Metochien (
serbisch Metohija/Метохија,
albanisch Rrafsh i Dukagjinit) ist im offiziellen Sprachgebrauch
Serbiens die Bezeichnung für den westlichen Teil des
Kosovo. Die offizielle serbische Bezeichnung für den Kosovo lautet Autonome Provinz Kosovo und Metochien (Autonomna pokrajina Kosovo i
Metohija).
Geographie
Das Gebiet Metochiens ist ein von hohen Gebirgen umgebenes Tiefland. Es ist im Osten durch den
Crnoljeva, einen niedrigen Gebirgszug, vom
Amselfeld (Kosovo polje) getrennt.
[1]
Metochien oder Rrafsh i Dukagjinit (zu deutsch "Ebene des Traubenmosts") besteht aus den früheren
serbischen Bezirken
Peć und
Prizren und hat eine Fläche von 3340 km². Die Bevölkerung belief sich 2002 auf 790.272, oder 40 Prozent der Gesamtbevölkerung des Kosovo von 1.956.194. Inoffizielle Hauptstadt (Zentrum und größte Stadt) ist
Prizren. Metochien ist an der breitesten Stelle 23 km breit, etwa 60 km lang. Die durchschnittliche Meereshöhe beträgt 550 Meter. Der Hauptfluss ist der
Weiße Drin, ein Nebenfluss des
Schwarzen Drin. Eingekreist ist die Region vom Gebirge
Mokra Gora im Norden, der
Prokletije oder
Bjeshkët e Nemuna im Westen, der
Šar Planina im Süden und der
Drenica im Osten, welches auch die ungefähre Grenze zum Kosovo bildet.
Geschichte
Die Bezeichnung leitet sich vom griechischen
metochi (
mgr. μετοχή ‚Gemeinschaft‘) ab und knüpft an die mittelalterlichen klösterlichen Gemeinschaften, die einen Großteil des Landes in dieser Gegend Kosovos besaßen. Entstanden ist die Bezeichnung im 19. Jahrhundert, als das Gebiet noch zum Osmanischen Reich gehörte. Die früheren serbischen Bezeichnungen für Metochien waren
Hvosno für die nördlichen,
Patkovo für die mittleren und
Prizrener Land für die südlichen Gebiete.
Die Landschaft, die im Mittelalter noch nicht den Namen
Metohija trug, war in mehrere Župe (Gaue) gegliedert.
[1] Um 1180 geriet das Gebiet unter die Herrschaft der
Nemanjiden.
[1] Metohija war das am weitesten entwickelte Gebiet im mittelalterlichen Serbien. In
Metohija befanden sich zwei Bischofssitze, der Sitz des
serbisch-orthodoxen Erzbischofs in Peć, sowie zahlreiche Klöster, Kirchen und Märkte.
[1] In Prizren, einem bedeutenden Handels- und Gewerbezentrum, befand sich einer der Höfe des serbischen Zaren.
[1]
Der Begriff "Metochien" wurde offiziell in Serbien erst seit 1945 verwendet. Der serbische König
Petar sprach in einer Proklamation „An das serbische Volk“ bei der Beendigung des
Zweiten Balkankriegs von „Altserbien“, womit alle von Serbien und Montenegro in den Balkankriegen eroberten Gebiete gemeint waren.
[2] Österreichische Quellen des 17. Jahrhunderts bezeichnen mit "Altserbien" und "Türkisch-Serbien" die vormals serbischen Länder im Osmanischen Reich, einschließlich des Kosovo und Metochiens.
[3]
Nach dem Sieg über das Osmanische Reich in den
Balkankriegen wurde das Gebiet zwischen Serbien und Montenegro aufgeteilt, die Umgebung der Städte Peć und Đakovica fiel an
Montenegro.
Im
Königreich SHS, seit 1929 Jugoslawien, gehörte das Gebiet zur
Zetska banovina.
[4]
Das erste offizielle Dokument, in dem der Name
Metohija (Metochien) zum Teil auftaucht, ist das Protokoll der II. Tagung des
AVNOJ am 29. September 1943; dort wurde die Schaffung eines „Autonomen Gebiets
Kosmet“ (Abkürzung für Kosovo-Metohija, siehe BiH für Bosna i Hercegovina) beschlossen.
[5]. Das Gebiet gehörte zu diesem Zeitpunkt zum erst italienischen, dann deutschen Satellitenstaat
Großalbanien. Um die
Kosovo-Albaner für den Partisanenkampf einzunehmen, stellten Vertreter der
KPJ nach der
Konferenz von Bujan im Januar 1944 eine Vereinigung des ganzen Kosovo mit Albanien in Aussicht und sprachen in deren Abschlussdokument von „Kosovo und der Dukagjin-Ebene“
[6]. Die Beschlüsse der Konferenz wurden auf Verlangen
Titos aber rückgängig gemacht und das Gebiet wurde im November 1945 als Bestandteil des
Autonomen Gebiets Kosmet (seit 1963 Autonome Provinz Kosmet) im serbischen Staatsverband an Jugoslawien angeschlossen. Die Bezeichnung wurde von den Albanern abgelehnt, weil sie an den umfangreichen serbischen Kirchenbesitz in Metochien erinnerte und vorher noch nie so geheissen hatte. Nach der Entmachtung des jugoslawischen Innenministers
Aleksandar Ranković wurde die Provinz 1967 in Kosovo umbenannt. Serben, die mit der von Tito verfolgten Kosovo-Politik nicht einverstanden waren, verwendeten seitdem bewusst den Terminus „Kosmet“
[7]. In den 80er Jahren verwendete auch die
Serbisch-Orthodoxe Kirche in einem an die serbische Regierung gerichteten „Appell zum Schutz der geistigen und biologischen Existenz der Serben im Kosovo“ den Begriff „Metochien“ nicht
[8]. Im
SANU-Memorandum von 1986 wurde jedoch wiederholt von „Kosovo und Metohija“ gesprochen
[9]. Im Zuge der 1989 und 1990 in Serbien vorgenommenen Verfassungsänderungen, mit denen die Autonomierechte des Kosovo weitgehend aufgehoben wurden, erhielt die Provinz wieder den voll ausgeschriebenen Namen „Kosovo-Metohija“.