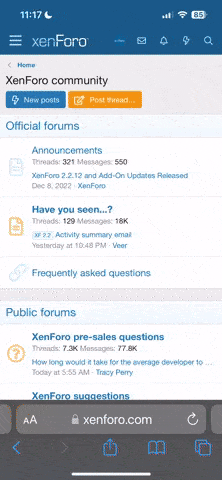lupo-de-mare
Gesperrt
Ein guter Artikel in der SZ von heute, den eine bekannte Holländische Politikerin geschrieben hat.
"Ayaan Hirsi Ali ist von ihren Eltern zu einer guten Muslima erzogen worden. Dazu gehörte, dass sie als kleines Mädchen in Afrika fünfmal am Tag für die Ausrottung der Juden betete. Dass sie lernte, Ungläubige als unmoralisch und asozial zu sehen."
Die holländische Islamkritikerin Ayaan Hirsi Ali: Eine Frau hantiert mit explosivem Stoff
Aufgebrochen, um auszubrechen
Dass sie auf der Todesliste der Radikalen steht, ist für die junge Politikerin längst harter Alltag -- dass sie noch lächeln kann, grenzt an ein Wunder
Von Stefan Klein
Berlin, 30. Mai -- Eine Anklägerin stellt man sich anders vor -- energisch, scharf, schneidend. Ihr Auftreten müsste Furcht einflößen, ihre Stimme Respekt gebieten, ihr Gestus einschüchternd wirken. Von Ayaan Hirsi Ali geht nichts dergleichen aus. Ihre Stimme ist weich und leise, sie wirkt zurückhaltend, beinahe scheu, und vielleicht ist sie ja auch ein bisschen peinlich berührt von all dem Aufwand, der um sie getrieben wird. Zum Beispiel, dass vor dem Hotel zwei BMWs stehen vom Landeskriminalamt, mit denen vier Sicherheitsbeamte gekommen sind -- zu ihrem Schutz. Oder dass oben auf der Dachterrasse über den Dächern von Berlin, wo nun gleich das Gespräch stattfinden soll, zwei weitere Personenschützer sitzen, die am Tag davor mit ihr aus Holland eingeflogen sind -- ebenfalls zu ihrem Schutz. Bundeskanzler leben so, Staatsanwälte in Palermo auch, aber eine Emigrantin aus Somalia?
Es gibt Geschichten, Lebensgeschichten, die erzählen sich von selber -- aus den Augen, aus dem Gesicht. Das Gesicht der Anklägerin Ayaan Hirsi Ali ist das einer erkennbar jungen Frau. Es ist vielleicht ein bisschen ernster als andere, ein bisschen müder, ein bisschen schöner, aber eine Geschichte erzählt es nicht. Jedenfalls nicht die Geschichte, wie es kam, dass ein Flüchtling aus Afrika zur meistgefährdeten Person der Niederlande wurde. Wie ein politisches Buch mit Aufsätzen und Essays, die sie geschrieben hat, in Deutschland innerhalb von nur zehn Tagen 20 000 Mal verkauft wurde und in einem Rutsch seinen Weg in die Bestsellerlisten fand. So wie zuvor schon in Italien und demnächst womöglich in Frankreich und Skandinavien. Es ist ein Buch mit dem Bild der Ayaan Hirsi Ali auf dem Umschlag und dem Titel: "Ich klage an."
Der Bauch als Söhnefabrik
Anklagen: Sie tut das schon länger, und sie weiß nur zu gut, dass es hochexplosiver Stoff ist, mit dem sie hantiert. Ihr Thema ist der Islam oder vielmehr das, was sie seine "hässlichen Muttermale" nennt -- seine Rückständigkeit, seine grausamen Praktiken, seine Frauenfeindlichkeit, kurzum all das, was nach ihrem Urteil mit einer freiheitlichen Gesellschaft nicht in Einklang zu bringen ist. Attackiert hat sie diese Missstände immer wieder, einmal auch mit einem auf größtmögliche Provokation angelegten Kurzfilm namens "Submission" (Unterwerfung), und welche Folge der hatte, weiß man: Der Regisseur Theo van Gogh wurde auf der Straße niedergestochen, von einem muslimischen Fanatiker. Es war dies ganz offensichtlich ein Ersatzmord, weil man an das eigentliche Ziel, die seinerzeit schon von Bodyguards geschützte Hirsi Ali, nicht herankam. Sie hatte das Drehbuch geschrieben.
Ihr Thema ist aber auch der, wie sie findet, verderbliche Einfluss der Linken, der Liberalen, der politisch Korrekten in dieser Frage. Eigentlich ist sie ja selber eine Linke. Hirsi Ali war mal in der holländischen Arbeiterpartei, aber inzwischen ist sie Parlamentsabgeordnete der rechtsliberalen "Volkspartei für Freiheit und Demokratie" (VVD), und zwar weil sie an dem Widerspruch der Linken schier krank geworden ist. Diesem Widerspruch, der darin besteht, dass die mit ihrer Schonhaltung gegenüber muslimischen Minderheiten in Europa, ihrem Dulden und Tolerieren, ihrem ewigen Verständnis für die vermeintlichen Opfer genau die Rückständigkeit zementieren, die sie doch eigentlich beseitigen wollen. Mit der Folge, dass sich nichts ändert an Frauenbeschneidung, an Ehrenmorden, an Zwangsheiraten und Vergewaltigungen in der Ehe.
Derlei anzuprangern ist in den Augen frommer Muslime eine ganz besonders verabscheuungswürdige Sünde, wenn sie nicht etwa von einem Kuffar begangen wird, einem gewissenlosen Ungläubigen, von dem nichts anderes zu erwarten ist, sondern von jemandem, der glaubt -- oder doch wenigstens geglaubt hat. Ayaan Hirsi Ali ist von ihren Eltern zu einer guten Muslima erzogen worden. Dazu gehörte, dass sie als kleines Mädchen in Afrika fünfmal am Tag für die Ausrottung der Juden betete. Dass sie lernte, Ungläubige als unmoralisch und asozial zu sehen. Dass sie, wenn auch gegen den Widerstand des Vaters, aber erzwungen von der Großmutter, im Alter von fünf Jahren beschnitten wurde. Viel fehlte nicht, und die Eltern hätten ihr Ziel erreicht: Als Heranwachsende trug Hirsi Ali plötzlich schwarze Gewänder über der Schuluniform, legte den Schleier um und wollte Märtyrerin werden.
Doch es gab auch Zeichen, die in die andere Richtung deuteten. Gegen den privaten Koranlehrer, der sie Suren auf Bretter schreiben ließ, begehrte das Mädchen Ayaan auf, zahlte aber dafür mit einer schrecklichen Tracht Prügel und einem Schädelbasisbruch. Wenn die Großmutter von dem einen Enkel sprach, den sie habe, und so tat, als zählten die fünf Enkelinnen nicht, fragten Ayaan und ihre Schwestern: "Und wir?" Ihr, entgegnete die Großmutter, werdet Söhne bekommen. Ayaan, die Neunjährige, fand das empörend. Sie wollte keine Söhnefabrik sein. Es sind diese persönlichen Passagen ihres Buches, die am eindrücklichsten sind. Der früh eingeimpfte Judenhass und später die Überraschung, als Hirsi Ali zum erstenmal einem Juden gegenüberstand und feststellte, dass es "ganz offensichtlich ein normaler Mensch aus Fleisch und Blut war."
Es ist ein warmer Frühsommertag in Berlin. Nicht so drückend heiß wie er in Mogadischu wäre, Hirsi Alis Geburtsort, und gerade deshalb vielleicht besonders gut geeignet, um loszuziehen in die Stadt, die ja viel zu bieten hat, zum Beispiel dieses neue Mahnmal zur Erinnerung an den Holocaust. Ja, sagt Hirsi Ali auf dem Dach ihres Hotels, von dem Stelenfeld habe sie gehört, und das würde sie auch gerne sehen. Aber sie wird in diesen Tagen heftig vermarktet von ihrem Verlag, es gibt viele Termine und wenig freie Zeit. Hirsi Ali sagt nicht, dass es aus Sicherheitsgründen nicht möglich sei. Das nämlich wäre es durchaus. War sie nicht eben erst zum Mittagessen im "Café Einstein" in der Kurfürstenstraße? Doch, war sie, wenn auch nicht allein, sondern mit sechs Schatten um sie herum. Sie sagt: "Ich kann machen, was ich will, es ist nur so, dass mir immer ein paar Männer folgen."
Rushdies Schicksalsgefährtin
Zweieinhalb Jahre geht das nun schon so, und es sei, sagt Hirsi Ali, als würde sie wieder mit ihren Eltern leben: "Du musst dauernd sagen, was du vorhast und um Erlaubnis bitten." Sie lacht darüber, obwohl ihr vielleicht eher zum Weinen ist. Schicksalsgenosse Salman Rushdie hat sie getröstet. Er hat ihr gesagt, es werde gute Tage geben und schlechte, aber irgendwann werde es vorüber sein, "und dann wirst du an der Straße stehen und ganz allein in ein Taxi steigen und begreifen, dass du wieder frei bist". Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Es gibt einen nicht nachlassenden Strom von Todesdrohungen, und das Buch, in dem der Prophet Mohammed ein "perverser Tyrann" genannt und mit "Größenwahnsinnigen" wie Khomeini und Bin Laden verglichen wird, dürfte die Wellen der Erregung kaum glätten.
Hirsi Ali ist erst 35 Jahre alt, und da ist der Tod normalerweise kein Gedanke. Aber in ihrem Bewusstsein hat er sich verankert und ihr Zeitgefühl verändert. Sie sagt, sie lebe intensiver als früher und verschwende nichts von den 24 Stunden, die der Tag hat. Selbstmitleid erlaubt sie sich nicht, und ganz nüchtern beantwortet sie denn auch die Frage, ob sie ihren Kampf für einen aufgeklärten Islam nicht mit einem allzu hohen Preis bezahle. Alles sei relativ, sagt sie und erzählt von den Frauen Afrikas, die ja nur scheinbar frei seien. In Wahrheit seien sie gefangen in einem Kreislauf aus Armut und Krankheit, sie dagegen lebe in einem Land, das ihr "alle Möglichkeiten" biete. Das ist wahr, aber wahr ist eben auch, dass sich nicht alles relativieren lässt -- zum Beispiel der Schmerz über den Bruch mit dem Vater.
Die anrührendsten Stellen in dem Buch handeln von der Liebe zu ihrem Vater, dem Politiker Hirsi Magan. Der seine schöne Ayaan umschmeichelte und dann allein ließ. Bis nächstes Wochenende, sagte er und kam zehn Jahre später zurück. Der seine Tochter mit einem in Kanada lebenden Cousin verheiratete und sie verstieß, als sie sich der Zwangsehe durch Flucht nach Holland entzog. Sechs Jahre kein Wort, dann Versöhnung, Wiedersehen, ein neuer Bruch, eine neue Annäherung, und seit letztem Jahr, seit "Submission", wieder Kontaktsperre. Für die Tochter ist das "äußerst hart", aber sie weiß, dass es keine tragfähige Brücke geben kann zwischen einem Gläubigen und einer, die sich von ihrem Glauben losgesagt hat. Zwar mag sie Religion als Trostspenderin durchaus akzeptieren, aber nicht "als Eichmaß der Moral, als Richtschnur für das Leben".
Das ist der Kern ihres Konflikts mit dem Islam, den sie austrägt und dabei auch jene nicht schont, die "aus Angst zu verletzen" sich weigern, "uns Muslime mit unserem Wahn zu konfrontieren." Den Zuckerguss von Verständnis will sie aufgebrochen und zum Beispiel die islamischen Schulen abgeschafft haben, weil da nur die verhängnisvollen Stereotypen verstärkt würden. Die normalen Schulen dagegen böten die Gelegenheit, das kritische Denken zu fördern, sexuell aufzuklären und im ständigen Kontakt mit Nichtmuslimen all die Fähigkeiten zu lernen, die es braucht, um sich in einer offenen westlichen Gesellschaft und vor allem auch in einem hart umkämpften Arbeitsmarkt zu behaupten. Die Ghettos solle man öffnen, fordert Hirsi Ali, so wie es in Rotterdam gerade versucht werde, und die sozialen Wohltaten dürfe man nicht gar so großzügig ausschütten, weil das nur faul und abhängig mache und den Druck verringere, sich den Werten und Normen der gastgebenden Gesellschaft anzupassen.
Solche Lektionen von einer politisch Unkorrekten, die sich nicht geniert dafür. Im Gegenteil: Was sie sagt, sagt sie sehr selbstbewusst, und wenn man sie nur ließe, die vielen Muslimas, die zwischen vier Wände verbannt und von ihren Männern in Unwissenheit gehalten werden, dann könnten sie in Hirsi Ali ein Vorbild sehen, ein Beispiel für das, was möglich ist. Nicht, dass es einfach gewesen wäre: Die Flucht, das Leben in einem Heim für Asylbewerber, das Lernen einer fremden Sprache. Aber sie schlug sich durch, arbeitete in Abtreibungskliniken und Frauenhäusern als Dolmetscherin und lernte aus nächster Nähe kennen, was im Namen von Ehre und in der Furcht vor Schande muslimischen Frauen angetan wird. Sie weiß aus eigener Anschauung, wovon sie spricht, und sie hat nicht zufällig ihrem Buch ein Kapitel angefügt mit "zehn Tipps für Muslimas, die weglaufen wollen". Das ist eine konkrete Handlungsanleitung, und damit auch die wirklich Betroffenen sie verstehen, wird der Piper-Verlag zusätzlich eine türkische Ausgabe des Buches auf den Markt bringen.
Und Schattenmänner laufen mit
Später hat sie noch Politikwissenschaften studiert und sich so neben dem praktischen auch noch das theoretische Rüstzeug erarbeitet für ihren Kampf, von dem sie sagt, dass sie ihn nicht aufgeben werde. Zwar gibt es immer mal wieder Augenblicke, in denen sie dies am liebsten täte und sich aus dem Auge des Wirbelsturms irgendwohin verkriechen würde, doch solche Anfechtungen haben keine Chance: "Wenn du etwas anfängst, dann bringst du es auch zu einem guten Ende. Du hörst nicht auf halbem Wege auf." Väter sprechen solche Sätze. Wenn sie sprechen. Ein gutes Ende? Hirsi Ali bezieht das nicht auf sich, sondern auf den Islam, den sie reformiert sehen will, modernisiert, aufgeklärt, vernünftig und auf seinen ihm zustehenden Platz verwiesen -- die Moschee und den Privatbereich.
Sie wird dafür tun, was ihr möglich ist, und sie wird es auf ihre Weise tun. Zum Beispiel durch "Submission II". Sie hat immer gesagt, dass sie dem ersten Film noch einen weiteren folgen lassen wird, und auch der Mord an Theo van Gogh hat sie davon nicht abgebracht. Nur wird sie diesmal darauf bestehen, dass der Regisseur anonym bleibt. Es soll zwar die künstlerische und die Meinungsfreiheit verteidigt werden gegen Verblendung und Fanatismus, aber nicht um den Preis, dass erneut Blut fließt. Der erste Film handelte von vier im Namen des Koran misshandelten Frauen im Konflikt mit Gott, beim zweiten wird es um Männer gehen und den Nachweis, dass auch ihnen der Koran das Fortkommen erschwert. Das Drehbuch hat Hirsi Ali weitgehend fertig, mit einem möglichen Regisseur ist sie im Gespräch.
Ein weiterer Kurzfilm also, und dann vielleicht auch noch ihre Memoiren. Ayaan Hirsi Ali, so scheint es, lässt nicht locker. Sie hat eine Welle ausgelöst, und darauf reitet sie. Aber wer um die damit verbundenen tödlichen Gefahren weiß, wird es ihr nicht vorwerfen. Am Montag ist der Sommer in Berlin wieder vorbei, aber es hat sich eine Lücke gefunden im Terminkalender, und die schlanke, schwarzhäutige Frau im Stelenfeld wird vielleicht daran denken, wie sie einst als Kind für die Vernichtung der Juden gebetet hat -- weil es so Brauch war und weil es die Erwachsenen so wollten. Sie ist wieder nicht allein, sechs Schattenmänner halten Wache, und für die ist so ein belebter öffentlicher Platz eine ziemliche Herausforderung.
(SZ vom 31.5.2005)
http://www.sueddeutsche.de/app/serv...005&de=31.12.2005&wm=wrd&wf=222210&ps=5&m=all
"Ayaan Hirsi Ali ist von ihren Eltern zu einer guten Muslima erzogen worden. Dazu gehörte, dass sie als kleines Mädchen in Afrika fünfmal am Tag für die Ausrottung der Juden betete. Dass sie lernte, Ungläubige als unmoralisch und asozial zu sehen."
Die holländische Islamkritikerin Ayaan Hirsi Ali: Eine Frau hantiert mit explosivem Stoff
Aufgebrochen, um auszubrechen
Dass sie auf der Todesliste der Radikalen steht, ist für die junge Politikerin längst harter Alltag -- dass sie noch lächeln kann, grenzt an ein Wunder
Von Stefan Klein
Berlin, 30. Mai -- Eine Anklägerin stellt man sich anders vor -- energisch, scharf, schneidend. Ihr Auftreten müsste Furcht einflößen, ihre Stimme Respekt gebieten, ihr Gestus einschüchternd wirken. Von Ayaan Hirsi Ali geht nichts dergleichen aus. Ihre Stimme ist weich und leise, sie wirkt zurückhaltend, beinahe scheu, und vielleicht ist sie ja auch ein bisschen peinlich berührt von all dem Aufwand, der um sie getrieben wird. Zum Beispiel, dass vor dem Hotel zwei BMWs stehen vom Landeskriminalamt, mit denen vier Sicherheitsbeamte gekommen sind -- zu ihrem Schutz. Oder dass oben auf der Dachterrasse über den Dächern von Berlin, wo nun gleich das Gespräch stattfinden soll, zwei weitere Personenschützer sitzen, die am Tag davor mit ihr aus Holland eingeflogen sind -- ebenfalls zu ihrem Schutz. Bundeskanzler leben so, Staatsanwälte in Palermo auch, aber eine Emigrantin aus Somalia?
Es gibt Geschichten, Lebensgeschichten, die erzählen sich von selber -- aus den Augen, aus dem Gesicht. Das Gesicht der Anklägerin Ayaan Hirsi Ali ist das einer erkennbar jungen Frau. Es ist vielleicht ein bisschen ernster als andere, ein bisschen müder, ein bisschen schöner, aber eine Geschichte erzählt es nicht. Jedenfalls nicht die Geschichte, wie es kam, dass ein Flüchtling aus Afrika zur meistgefährdeten Person der Niederlande wurde. Wie ein politisches Buch mit Aufsätzen und Essays, die sie geschrieben hat, in Deutschland innerhalb von nur zehn Tagen 20 000 Mal verkauft wurde und in einem Rutsch seinen Weg in die Bestsellerlisten fand. So wie zuvor schon in Italien und demnächst womöglich in Frankreich und Skandinavien. Es ist ein Buch mit dem Bild der Ayaan Hirsi Ali auf dem Umschlag und dem Titel: "Ich klage an."
Der Bauch als Söhnefabrik
Anklagen: Sie tut das schon länger, und sie weiß nur zu gut, dass es hochexplosiver Stoff ist, mit dem sie hantiert. Ihr Thema ist der Islam oder vielmehr das, was sie seine "hässlichen Muttermale" nennt -- seine Rückständigkeit, seine grausamen Praktiken, seine Frauenfeindlichkeit, kurzum all das, was nach ihrem Urteil mit einer freiheitlichen Gesellschaft nicht in Einklang zu bringen ist. Attackiert hat sie diese Missstände immer wieder, einmal auch mit einem auf größtmögliche Provokation angelegten Kurzfilm namens "Submission" (Unterwerfung), und welche Folge der hatte, weiß man: Der Regisseur Theo van Gogh wurde auf der Straße niedergestochen, von einem muslimischen Fanatiker. Es war dies ganz offensichtlich ein Ersatzmord, weil man an das eigentliche Ziel, die seinerzeit schon von Bodyguards geschützte Hirsi Ali, nicht herankam. Sie hatte das Drehbuch geschrieben.
Ihr Thema ist aber auch der, wie sie findet, verderbliche Einfluss der Linken, der Liberalen, der politisch Korrekten in dieser Frage. Eigentlich ist sie ja selber eine Linke. Hirsi Ali war mal in der holländischen Arbeiterpartei, aber inzwischen ist sie Parlamentsabgeordnete der rechtsliberalen "Volkspartei für Freiheit und Demokratie" (VVD), und zwar weil sie an dem Widerspruch der Linken schier krank geworden ist. Diesem Widerspruch, der darin besteht, dass die mit ihrer Schonhaltung gegenüber muslimischen Minderheiten in Europa, ihrem Dulden und Tolerieren, ihrem ewigen Verständnis für die vermeintlichen Opfer genau die Rückständigkeit zementieren, die sie doch eigentlich beseitigen wollen. Mit der Folge, dass sich nichts ändert an Frauenbeschneidung, an Ehrenmorden, an Zwangsheiraten und Vergewaltigungen in der Ehe.
Derlei anzuprangern ist in den Augen frommer Muslime eine ganz besonders verabscheuungswürdige Sünde, wenn sie nicht etwa von einem Kuffar begangen wird, einem gewissenlosen Ungläubigen, von dem nichts anderes zu erwarten ist, sondern von jemandem, der glaubt -- oder doch wenigstens geglaubt hat. Ayaan Hirsi Ali ist von ihren Eltern zu einer guten Muslima erzogen worden. Dazu gehörte, dass sie als kleines Mädchen in Afrika fünfmal am Tag für die Ausrottung der Juden betete. Dass sie lernte, Ungläubige als unmoralisch und asozial zu sehen. Dass sie, wenn auch gegen den Widerstand des Vaters, aber erzwungen von der Großmutter, im Alter von fünf Jahren beschnitten wurde. Viel fehlte nicht, und die Eltern hätten ihr Ziel erreicht: Als Heranwachsende trug Hirsi Ali plötzlich schwarze Gewänder über der Schuluniform, legte den Schleier um und wollte Märtyrerin werden.
Doch es gab auch Zeichen, die in die andere Richtung deuteten. Gegen den privaten Koranlehrer, der sie Suren auf Bretter schreiben ließ, begehrte das Mädchen Ayaan auf, zahlte aber dafür mit einer schrecklichen Tracht Prügel und einem Schädelbasisbruch. Wenn die Großmutter von dem einen Enkel sprach, den sie habe, und so tat, als zählten die fünf Enkelinnen nicht, fragten Ayaan und ihre Schwestern: "Und wir?" Ihr, entgegnete die Großmutter, werdet Söhne bekommen. Ayaan, die Neunjährige, fand das empörend. Sie wollte keine Söhnefabrik sein. Es sind diese persönlichen Passagen ihres Buches, die am eindrücklichsten sind. Der früh eingeimpfte Judenhass und später die Überraschung, als Hirsi Ali zum erstenmal einem Juden gegenüberstand und feststellte, dass es "ganz offensichtlich ein normaler Mensch aus Fleisch und Blut war."
Es ist ein warmer Frühsommertag in Berlin. Nicht so drückend heiß wie er in Mogadischu wäre, Hirsi Alis Geburtsort, und gerade deshalb vielleicht besonders gut geeignet, um loszuziehen in die Stadt, die ja viel zu bieten hat, zum Beispiel dieses neue Mahnmal zur Erinnerung an den Holocaust. Ja, sagt Hirsi Ali auf dem Dach ihres Hotels, von dem Stelenfeld habe sie gehört, und das würde sie auch gerne sehen. Aber sie wird in diesen Tagen heftig vermarktet von ihrem Verlag, es gibt viele Termine und wenig freie Zeit. Hirsi Ali sagt nicht, dass es aus Sicherheitsgründen nicht möglich sei. Das nämlich wäre es durchaus. War sie nicht eben erst zum Mittagessen im "Café Einstein" in der Kurfürstenstraße? Doch, war sie, wenn auch nicht allein, sondern mit sechs Schatten um sie herum. Sie sagt: "Ich kann machen, was ich will, es ist nur so, dass mir immer ein paar Männer folgen."
Rushdies Schicksalsgefährtin
Zweieinhalb Jahre geht das nun schon so, und es sei, sagt Hirsi Ali, als würde sie wieder mit ihren Eltern leben: "Du musst dauernd sagen, was du vorhast und um Erlaubnis bitten." Sie lacht darüber, obwohl ihr vielleicht eher zum Weinen ist. Schicksalsgenosse Salman Rushdie hat sie getröstet. Er hat ihr gesagt, es werde gute Tage geben und schlechte, aber irgendwann werde es vorüber sein, "und dann wirst du an der Straße stehen und ganz allein in ein Taxi steigen und begreifen, dass du wieder frei bist". Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Es gibt einen nicht nachlassenden Strom von Todesdrohungen, und das Buch, in dem der Prophet Mohammed ein "perverser Tyrann" genannt und mit "Größenwahnsinnigen" wie Khomeini und Bin Laden verglichen wird, dürfte die Wellen der Erregung kaum glätten.
Hirsi Ali ist erst 35 Jahre alt, und da ist der Tod normalerweise kein Gedanke. Aber in ihrem Bewusstsein hat er sich verankert und ihr Zeitgefühl verändert. Sie sagt, sie lebe intensiver als früher und verschwende nichts von den 24 Stunden, die der Tag hat. Selbstmitleid erlaubt sie sich nicht, und ganz nüchtern beantwortet sie denn auch die Frage, ob sie ihren Kampf für einen aufgeklärten Islam nicht mit einem allzu hohen Preis bezahle. Alles sei relativ, sagt sie und erzählt von den Frauen Afrikas, die ja nur scheinbar frei seien. In Wahrheit seien sie gefangen in einem Kreislauf aus Armut und Krankheit, sie dagegen lebe in einem Land, das ihr "alle Möglichkeiten" biete. Das ist wahr, aber wahr ist eben auch, dass sich nicht alles relativieren lässt -- zum Beispiel der Schmerz über den Bruch mit dem Vater.
Die anrührendsten Stellen in dem Buch handeln von der Liebe zu ihrem Vater, dem Politiker Hirsi Magan. Der seine schöne Ayaan umschmeichelte und dann allein ließ. Bis nächstes Wochenende, sagte er und kam zehn Jahre später zurück. Der seine Tochter mit einem in Kanada lebenden Cousin verheiratete und sie verstieß, als sie sich der Zwangsehe durch Flucht nach Holland entzog. Sechs Jahre kein Wort, dann Versöhnung, Wiedersehen, ein neuer Bruch, eine neue Annäherung, und seit letztem Jahr, seit "Submission", wieder Kontaktsperre. Für die Tochter ist das "äußerst hart", aber sie weiß, dass es keine tragfähige Brücke geben kann zwischen einem Gläubigen und einer, die sich von ihrem Glauben losgesagt hat. Zwar mag sie Religion als Trostspenderin durchaus akzeptieren, aber nicht "als Eichmaß der Moral, als Richtschnur für das Leben".
Das ist der Kern ihres Konflikts mit dem Islam, den sie austrägt und dabei auch jene nicht schont, die "aus Angst zu verletzen" sich weigern, "uns Muslime mit unserem Wahn zu konfrontieren." Den Zuckerguss von Verständnis will sie aufgebrochen und zum Beispiel die islamischen Schulen abgeschafft haben, weil da nur die verhängnisvollen Stereotypen verstärkt würden. Die normalen Schulen dagegen böten die Gelegenheit, das kritische Denken zu fördern, sexuell aufzuklären und im ständigen Kontakt mit Nichtmuslimen all die Fähigkeiten zu lernen, die es braucht, um sich in einer offenen westlichen Gesellschaft und vor allem auch in einem hart umkämpften Arbeitsmarkt zu behaupten. Die Ghettos solle man öffnen, fordert Hirsi Ali, so wie es in Rotterdam gerade versucht werde, und die sozialen Wohltaten dürfe man nicht gar so großzügig ausschütten, weil das nur faul und abhängig mache und den Druck verringere, sich den Werten und Normen der gastgebenden Gesellschaft anzupassen.
Solche Lektionen von einer politisch Unkorrekten, die sich nicht geniert dafür. Im Gegenteil: Was sie sagt, sagt sie sehr selbstbewusst, und wenn man sie nur ließe, die vielen Muslimas, die zwischen vier Wände verbannt und von ihren Männern in Unwissenheit gehalten werden, dann könnten sie in Hirsi Ali ein Vorbild sehen, ein Beispiel für das, was möglich ist. Nicht, dass es einfach gewesen wäre: Die Flucht, das Leben in einem Heim für Asylbewerber, das Lernen einer fremden Sprache. Aber sie schlug sich durch, arbeitete in Abtreibungskliniken und Frauenhäusern als Dolmetscherin und lernte aus nächster Nähe kennen, was im Namen von Ehre und in der Furcht vor Schande muslimischen Frauen angetan wird. Sie weiß aus eigener Anschauung, wovon sie spricht, und sie hat nicht zufällig ihrem Buch ein Kapitel angefügt mit "zehn Tipps für Muslimas, die weglaufen wollen". Das ist eine konkrete Handlungsanleitung, und damit auch die wirklich Betroffenen sie verstehen, wird der Piper-Verlag zusätzlich eine türkische Ausgabe des Buches auf den Markt bringen.
Und Schattenmänner laufen mit
Später hat sie noch Politikwissenschaften studiert und sich so neben dem praktischen auch noch das theoretische Rüstzeug erarbeitet für ihren Kampf, von dem sie sagt, dass sie ihn nicht aufgeben werde. Zwar gibt es immer mal wieder Augenblicke, in denen sie dies am liebsten täte und sich aus dem Auge des Wirbelsturms irgendwohin verkriechen würde, doch solche Anfechtungen haben keine Chance: "Wenn du etwas anfängst, dann bringst du es auch zu einem guten Ende. Du hörst nicht auf halbem Wege auf." Väter sprechen solche Sätze. Wenn sie sprechen. Ein gutes Ende? Hirsi Ali bezieht das nicht auf sich, sondern auf den Islam, den sie reformiert sehen will, modernisiert, aufgeklärt, vernünftig und auf seinen ihm zustehenden Platz verwiesen -- die Moschee und den Privatbereich.
Sie wird dafür tun, was ihr möglich ist, und sie wird es auf ihre Weise tun. Zum Beispiel durch "Submission II". Sie hat immer gesagt, dass sie dem ersten Film noch einen weiteren folgen lassen wird, und auch der Mord an Theo van Gogh hat sie davon nicht abgebracht. Nur wird sie diesmal darauf bestehen, dass der Regisseur anonym bleibt. Es soll zwar die künstlerische und die Meinungsfreiheit verteidigt werden gegen Verblendung und Fanatismus, aber nicht um den Preis, dass erneut Blut fließt. Der erste Film handelte von vier im Namen des Koran misshandelten Frauen im Konflikt mit Gott, beim zweiten wird es um Männer gehen und den Nachweis, dass auch ihnen der Koran das Fortkommen erschwert. Das Drehbuch hat Hirsi Ali weitgehend fertig, mit einem möglichen Regisseur ist sie im Gespräch.
Ein weiterer Kurzfilm also, und dann vielleicht auch noch ihre Memoiren. Ayaan Hirsi Ali, so scheint es, lässt nicht locker. Sie hat eine Welle ausgelöst, und darauf reitet sie. Aber wer um die damit verbundenen tödlichen Gefahren weiß, wird es ihr nicht vorwerfen. Am Montag ist der Sommer in Berlin wieder vorbei, aber es hat sich eine Lücke gefunden im Terminkalender, und die schlanke, schwarzhäutige Frau im Stelenfeld wird vielleicht daran denken, wie sie einst als Kind für die Vernichtung der Juden gebetet hat -- weil es so Brauch war und weil es die Erwachsenen so wollten. Sie ist wieder nicht allein, sechs Schattenmänner halten Wache, und für die ist so ein belebter öffentlicher Platz eine ziemliche Herausforderung.
(SZ vom 31.5.2005)
http://www.sueddeutsche.de/app/serv...005&de=31.12.2005&wm=wrd&wf=222210&ps=5&m=all