-
Herzlich Willkommen im Balkanforum
Sind Sie neu hier? Dann werden Sie Mitglied in unserer Community.
Bitte hier registrieren
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Eurovision Song Contest Stockholm 2016
- Ersteller kewell
- Erstellt am
Weitere Optionen
Wer hat geantwortet?der twitter-account der nato scheint diese kirgisische tataren-ukrainerin auch sehr zu mögen.
http://www.twitter.com/NATO/status/732585655054766081
die haben schon im dezember ein video mit ihr hochgeladen.
wusste nicht, dass sich auch die nato für diese homovision interessiert :/
http://www.twitter.com/NATO/status/732585655054766081
die haben schon im dezember ein video mit ihr hochgeladen.
wusste nicht, dass sich auch die nato für diese homovision interessiert :/
SLO_CH86
Spitzen-Poster
Neben der Debatte darüber, wie der ESC-Siegersong der Ukrainerin Jamala politisch einzuordnen ist, sorgt vor allem das äußerst unterschiedliche Abstimmungsverhalten der Profi-Juroren im Vergleich zum Publikumsvoting für Diskussionen. Doch schon im Vorfeld ließ der britische Mirror die Bombe platzen: Die European Broadcasting Union (EBU) werde alles tun, um einen Sieg Russlands zu verhindern, so ein Insider am Freitag vor dem Gesangswettbewerbs gegenüber dem Blatt.
https://deutsch.rt.com/gesellschaft/38344-nun-wirds-offensichtlich--esc/
https://deutsch.rt.com/gesellschaft/38344-nun-wirds-offensichtlich--esc/
Eurovision Song Context: Wettbewerb zur Umdeutung der Geschichte
 Ein Priester hebt seine Hände auf einer Kundgebung im Zentrum von Simferopol am 28. März 1998. Damals lebten 271.000 Tataren auf der Krim.
Ein Priester hebt seine Hände auf einer Kundgebung im Zentrum von Simferopol am 28. März 1998. Damals lebten 271.000 Tataren auf der Krim.
Der Zweite Weltkrieg bestand aus einer Aneinanderreihung von Verbrechen und Unmenschlichkeit. Im aktuellen Geschichtsbild der Ukraine stehen Maßnahmen, die von den sowjetischen Behörden gegen Nazi-Kollaborateure ergriffen haben, ganz hoch im Kurs, wenn es darum geht, einen nationalen Mythos zu kreieren. Den ukrainischen UPA-Kollaborateuren geht es da nicht anders als einem Teil der Krim-Tataren, meint Gastautor Rainer Rupp.
von Rainer Rupp
Was war 1944 auf der Krim los? Mit welchen Untaten haben damals schon die bösen Russen die lokale Bevölkerung terrorisiert? Das fragen sich Zig Millionen Zuschauer rund um die Welt seit dem umstrittenen „Sieg der Ukraine über Russland“ beim Eurovision Song Contest (ESC). Denn für die meisten Menschen ist die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts und des Zweiten Weltkriegs ein Buch mit sieben Siegeln. Im besten Fall werden sich einige unter ihnen an die Geschichtslektion erinnern, die Arsenij Jazenjuk vor eineinhalb Jahren erteilte.
Jazenjuk, der nach dem von Washington unterstützten Gewaltputsch in Kiew von den USA zum Ministerpräsident der Ukraine ausgewählt worden war, hatte nämlich erzählt, dass die aus dem Osten kommenden, russischen Horden auf ihrem Weg zur Invasion Deutschlands 1944 schon einmal in der Ukraine eingefallen waren.
Aus der Sicht Jazenjuks ist das nur konsequent, denn die faschistischen Kräfte, die heute hinter der Regierung in Kiew stehen, hatten damals der Nazi-Wehrmacht und den SS-Sonderkommandos mit der Waffe in der Hand geholfen, die Ukraine von Kommunisten, Juden und Russen zu „säubern“. Diese Bandera-Banditen werden inzwischen in Kiew als Volkshelden verehrt.
Und was hat das mit dem Eurovision Song Contest zu tun? Alles! Denn das musikalisch mittelmäßige Liedchen „1944“ der ukrainischen Sängerin Jamala trägt die gleiche verheerende Botschaft in die Welt, die zuvor schon von Jazenjuk propagiert wurde, nur dass Jamala mit ihrer stark emotionsgeladenen, audio-visuellen Show mit Hilfe des ESC weitaus mehr Menschen erreicht hat.
Sie habe nur ein „ganz persönliches Lied“ geschrieben, säuselte Siegerin Jamala. Sie wollte nur erzählen, wie es ihrer Oma väterlicherseits ergangen sei, im Jahr 1944, als die Krim-Tartarin von den „Sowjets - das ist im aktuellen Kiewer Sprachgebrauch ein Synonym für "die Russen" - aus ihrer Heimat deportiert worden ist.
Wie konnten "die Russen" den scheinbar friedliebenden, unschuldigen Krimtartaren nur sowas antun? Nach dem Ende von Jamalas Liedchen steht diese Frage millionenfach im Raum. Für eine Antwort genügt ein Blick in das 2004 erschiene Buch „Ideologie und militärisches Kalkül. Die Besatzungspolitik der Wehrmacht in der Sowjetunion“ des deutschen Historikers Manfred Oldenburg.
Dort kann man ab Seite 119, wo das Kapitel „Die Bevorzugung der Tartaren“ beginnt, im Detail nachlesen, wie der Großteil dieser Minderheit nicht nur mit den Nazi-Besatzern kollaboriert hat, sondern bis zu 20.000 bewaffnete Tartaren den SS-Sonderkommandos und anderen Nazi-Einheiten bei der „Säuberung“ der Krim von Kommunisten, Juden und Russen aktiv zur Seite gestanden hatte.
Obwohl nachweislich ein Teil der Tartaren nicht kollaboriert hat, kann man sich leicht vorstellen, dass die verfolgten Überlebenden der Nazi-Besatzung nach der Befreiung der Krim 1944 durch die Sowjets die Kollaborateure und insbesondere die SS-Hilfskräfte unter den Tartaren nicht mit Samthandschuhen angefasst haben.
Es gehört schon eine Menge skrupelloser Unverfrorenheit dazu, um ein gefühlsduseliges Liedchen über die vollkommen aus dem geschichtlichen Zusammenhang gerissene Deportation der Krim-Tartaren-Oma in eine viele Hundert Millionen Mal verbreitete Anklage gegen "die Russen" umzufunktionieren.
Alte und neue Kalten Krieger haben den Eurovision-Wettbewerb auf perfide Weise politisiert. Der beste Beweis dafür ist die Art und Weise, wie westliche Kriegstreiber aus Politik und Medien diesmal den Musikwettbewerb begleitet haben, obwohl sie ihn sonst nie beachtet hatten.
Ein gutes Beispiel ist der bekannte Hardliner und Atlantiker Carl Bildt, ex-schwedischer Premier und Außenminister, der eine wichtige Rolle als Verbindungsmann zu den US-Neocons spielt, mit denen er das gemeinsame Projekt eines neuen Kalten Kriegs Russland vorantreibt. Eine „eindrucksvolle Leistung der Ukraine über das Schicksal der Tartaren“ hieß eine seiner vielen Kurznachrichten aus Stockholm, wo er als Beobachter am Eurovision Contest teilnahm. Die Musik kommentierte Bildt kein einziges Mal.
https://deutsch.rt.com/meinung/38372-eurovision-wettbewerb-zur-umdeutung-geschichte/

Der Zweite Weltkrieg bestand aus einer Aneinanderreihung von Verbrechen und Unmenschlichkeit. Im aktuellen Geschichtsbild der Ukraine stehen Maßnahmen, die von den sowjetischen Behörden gegen Nazi-Kollaborateure ergriffen haben, ganz hoch im Kurs, wenn es darum geht, einen nationalen Mythos zu kreieren. Den ukrainischen UPA-Kollaborateuren geht es da nicht anders als einem Teil der Krim-Tataren, meint Gastautor Rainer Rupp.
von Rainer Rupp
Was war 1944 auf der Krim los? Mit welchen Untaten haben damals schon die bösen Russen die lokale Bevölkerung terrorisiert? Das fragen sich Zig Millionen Zuschauer rund um die Welt seit dem umstrittenen „Sieg der Ukraine über Russland“ beim Eurovision Song Contest (ESC). Denn für die meisten Menschen ist die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts und des Zweiten Weltkriegs ein Buch mit sieben Siegeln. Im besten Fall werden sich einige unter ihnen an die Geschichtslektion erinnern, die Arsenij Jazenjuk vor eineinhalb Jahren erteilte.
Jazenjuk, der nach dem von Washington unterstützten Gewaltputsch in Kiew von den USA zum Ministerpräsident der Ukraine ausgewählt worden war, hatte nämlich erzählt, dass die aus dem Osten kommenden, russischen Horden auf ihrem Weg zur Invasion Deutschlands 1944 schon einmal in der Ukraine eingefallen waren.
Aus der Sicht Jazenjuks ist das nur konsequent, denn die faschistischen Kräfte, die heute hinter der Regierung in Kiew stehen, hatten damals der Nazi-Wehrmacht und den SS-Sonderkommandos mit der Waffe in der Hand geholfen, die Ukraine von Kommunisten, Juden und Russen zu „säubern“. Diese Bandera-Banditen werden inzwischen in Kiew als Volkshelden verehrt.
Und was hat das mit dem Eurovision Song Contest zu tun? Alles! Denn das musikalisch mittelmäßige Liedchen „1944“ der ukrainischen Sängerin Jamala trägt die gleiche verheerende Botschaft in die Welt, die zuvor schon von Jazenjuk propagiert wurde, nur dass Jamala mit ihrer stark emotionsgeladenen, audio-visuellen Show mit Hilfe des ESC weitaus mehr Menschen erreicht hat.
Sie habe nur ein „ganz persönliches Lied“ geschrieben, säuselte Siegerin Jamala. Sie wollte nur erzählen, wie es ihrer Oma väterlicherseits ergangen sei, im Jahr 1944, als die Krim-Tartarin von den „Sowjets - das ist im aktuellen Kiewer Sprachgebrauch ein Synonym für "die Russen" - aus ihrer Heimat deportiert worden ist.
Wie konnten "die Russen" den scheinbar friedliebenden, unschuldigen Krimtartaren nur sowas antun? Nach dem Ende von Jamalas Liedchen steht diese Frage millionenfach im Raum. Für eine Antwort genügt ein Blick in das 2004 erschiene Buch „Ideologie und militärisches Kalkül. Die Besatzungspolitik der Wehrmacht in der Sowjetunion“ des deutschen Historikers Manfred Oldenburg.
Dort kann man ab Seite 119, wo das Kapitel „Die Bevorzugung der Tartaren“ beginnt, im Detail nachlesen, wie der Großteil dieser Minderheit nicht nur mit den Nazi-Besatzern kollaboriert hat, sondern bis zu 20.000 bewaffnete Tartaren den SS-Sonderkommandos und anderen Nazi-Einheiten bei der „Säuberung“ der Krim von Kommunisten, Juden und Russen aktiv zur Seite gestanden hatte.
Obwohl nachweislich ein Teil der Tartaren nicht kollaboriert hat, kann man sich leicht vorstellen, dass die verfolgten Überlebenden der Nazi-Besatzung nach der Befreiung der Krim 1944 durch die Sowjets die Kollaborateure und insbesondere die SS-Hilfskräfte unter den Tartaren nicht mit Samthandschuhen angefasst haben.
Es gehört schon eine Menge skrupelloser Unverfrorenheit dazu, um ein gefühlsduseliges Liedchen über die vollkommen aus dem geschichtlichen Zusammenhang gerissene Deportation der Krim-Tartaren-Oma in eine viele Hundert Millionen Mal verbreitete Anklage gegen "die Russen" umzufunktionieren.
Alte und neue Kalten Krieger haben den Eurovision-Wettbewerb auf perfide Weise politisiert. Der beste Beweis dafür ist die Art und Weise, wie westliche Kriegstreiber aus Politik und Medien diesmal den Musikwettbewerb begleitet haben, obwohl sie ihn sonst nie beachtet hatten.
Ein gutes Beispiel ist der bekannte Hardliner und Atlantiker Carl Bildt, ex-schwedischer Premier und Außenminister, der eine wichtige Rolle als Verbindungsmann zu den US-Neocons spielt, mit denen er das gemeinsame Projekt eines neuen Kalten Kriegs Russland vorantreibt. Eine „eindrucksvolle Leistung der Ukraine über das Schicksal der Tartaren“ hieß eine seiner vielen Kurznachrichten aus Stockholm, wo er als Beobachter am Eurovision Contest teilnahm. Die Musik kommentierte Bildt kein einziges Mal.
https://deutsch.rt.com/meinung/38372-eurovision-wettbewerb-zur-umdeutung-geschichte/
Zeus
Geek
Seit 1997 gibt es den sogenannten „Barbara Dex Award“. Gekrönt werden die Teilnehmer mit dem schrecklichsten Outfit. Dieses Jahr gewann Kroatien mit ihrem Leuchtturm! 
eurovisionhouse.nl | barbara dex award
https://www.youtube.com/watch?v=8QUM-_EbE2o
eurovisionhouse.nl | barbara dex award
https://www.youtube.com/watch?v=8QUM-_EbE2o
Zeus
Geek
Songtexte, die oft falsch gehört wurden:
https://www.youtube.com/watch?v=TGoZxX3p4qI
https://www.youtube.com/watch?v=-7sa71vCj_g
https://www.youtube.com/watch?v=TGoZxX3p4qI
https://www.youtube.com/watch?v=-7sa71vCj_g
Zeus
Geek
Saara Aalto, eine Finnin, die die Vorentscheidungen leider nicht gewonnen hat, hat gerade einen Livestream auf Facebook. Sie ist mittlerweile im britischen XFactor und bisher sehr erfolgreich und beliebt: https://www.facebook.com/saaraaalto...¬if_t=live_video¬if_id=1473185986403021
Außerdem hat sie schon zwei meiner Kommentare vorgelesen!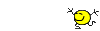
Außerdem hat sie schon zwei meiner Kommentare vorgelesen!
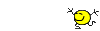
Hannibal
You see life through distorted eyes
Songtexte, die oft falsch gehört wurden:
https://www.youtube.com/watch?v=TGoZxX3p4qI
https://www.youtube.com/watch?v=-7sa71vCj_g
. .
Das sind keine Europäer
App installieren
So wird die App in iOS installiert
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.