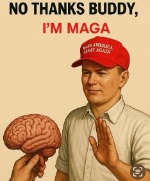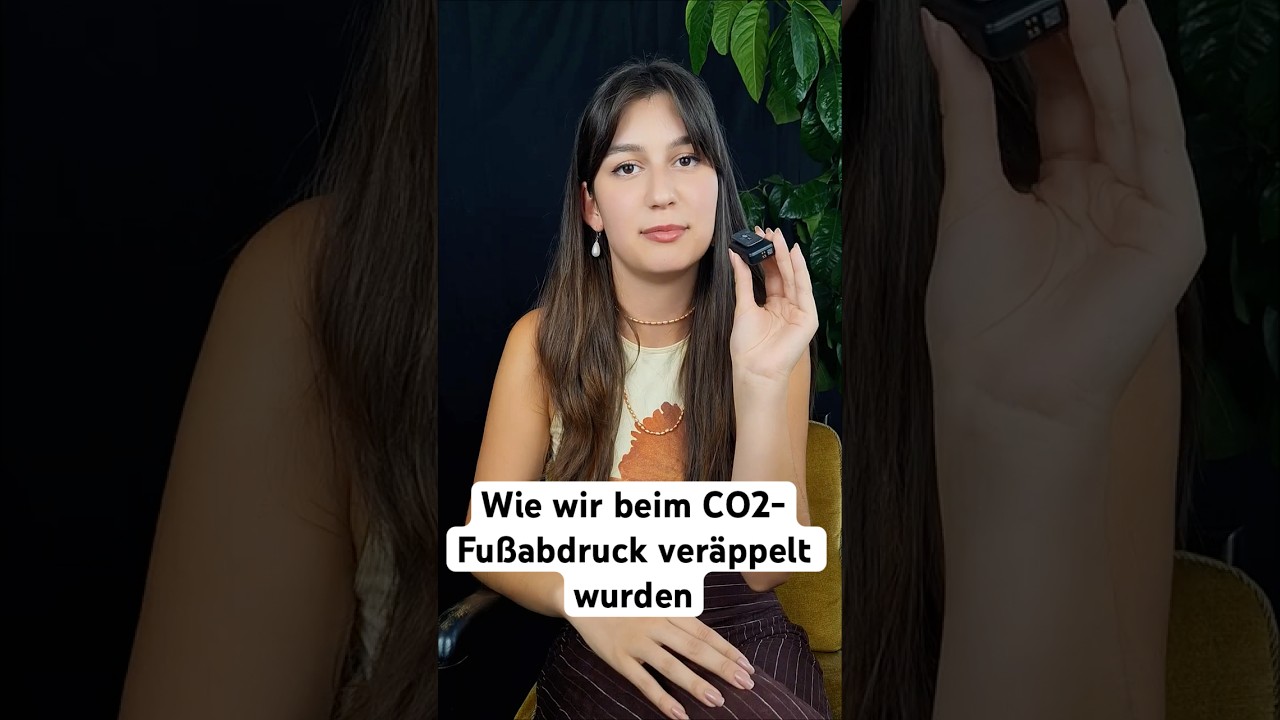Der Kreuzzug gegen den Wind – Wie Trump Amerikas Energiewende sabotiert
Es sind 679 Millionen Dollar, die Amerikas Zukunft kosten könnten. Am Freitag kündigte das US-Verkehrsministerium an, ein ganzes Paket an Bundesmitteln zu streichen – Gelder, die für den Aufbau von Häfen und Terminals vorgesehen waren, um die Offshore-Windkraft voranzutreiben. 12 Projekte quer durchs Land sind betroffen. Was für die Biden-Regierung ein Grundpfeiler der Energiewende war, wird unter Donald Trump zum Opfer einer politischen Abrechnung: Windkraft gilt im Weißen Haus als Feindbild. Besonders hart trifft es Kalifornien. Dort sollten 427 Millionen Dollar in Humboldt County in ein neues Terminal fließen, von dem aus schwimmende Windturbinen ins Meer gebracht werden sollten – ein zentrales Vorhaben, um die ehrgeizigen Klimaziele des Bundesstaates zu erreichen. Auch im Nordosten werden Visionen kassiert: 48 Millionen Dollar für einen Offshore-Windhafen auf Staten Island verschwinden ebenso wie 39 Millionen für die Modernisierung eines Hafens bei Norfolk in Virginia und 20 Millionen für ein Terminal in Paulsboro, New Jersey. All diese Orte waren als Knotenpunkte geplant, um gigantische Turbinen aufzubauen und hinaus auf den Atlantik zu bringen.
Verkehrsminister Sean Duffy verpackte den Schritt in eine rhetorische Offensive: „Verschwendung“ sei es, Geld in Windprojekte zu stecken, die besser für die maritime Industrie genutzt werden könnten. Doch hinter dieser Sprache steht ein Programm, das seit dem ersten Tag von Trumps zweiter Amtszeit konsequent durchgezogen wird: ein Feldzug gegen die erneuerbaren Energien. Schon am 20. Januar 2025, dem Tag seiner Vereidigung, verhängte Trump ein Moratorium auf alle neuen Offshore-Windgenehmigungen. Seit Wochen eskaliert die Regierung. Die Baustelle von Revolution Wind, einem sechs Milliarden Dollar schweren Großprojekt vor Rhode Island, wurde mit einem abrupten Baustopp belegt – obwohl es nahezu fertiggestellt war. Rhode Island und Connecticut protestierten scharf, bezeichneten den Schritt als rechtswidrig und warnten vor massiven Folgen für die Stromversorgung der Region. William Tong, Generalstaatsanwalt von Connecticut, kündigte umgehend Klage vor dem Bundesgericht in Massachusetts an: „Wir haben Milliarden investiert und ein Projekt, das kurz vor der Fertigstellung steht. Trumps irrationaler Stopp treibt die Strompreise hoch, vernichtet Arbeitsplätze und schwächt unser Netz.“

 kaizen-blog.org
kaizen-blog.org
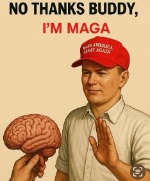
Es sind 679 Millionen Dollar, die Amerikas Zukunft kosten könnten. Am Freitag kündigte das US-Verkehrsministerium an, ein ganzes Paket an Bundesmitteln zu streichen – Gelder, die für den Aufbau von Häfen und Terminals vorgesehen waren, um die Offshore-Windkraft voranzutreiben. 12 Projekte quer durchs Land sind betroffen. Was für die Biden-Regierung ein Grundpfeiler der Energiewende war, wird unter Donald Trump zum Opfer einer politischen Abrechnung: Windkraft gilt im Weißen Haus als Feindbild. Besonders hart trifft es Kalifornien. Dort sollten 427 Millionen Dollar in Humboldt County in ein neues Terminal fließen, von dem aus schwimmende Windturbinen ins Meer gebracht werden sollten – ein zentrales Vorhaben, um die ehrgeizigen Klimaziele des Bundesstaates zu erreichen. Auch im Nordosten werden Visionen kassiert: 48 Millionen Dollar für einen Offshore-Windhafen auf Staten Island verschwinden ebenso wie 39 Millionen für die Modernisierung eines Hafens bei Norfolk in Virginia und 20 Millionen für ein Terminal in Paulsboro, New Jersey. All diese Orte waren als Knotenpunkte geplant, um gigantische Turbinen aufzubauen und hinaus auf den Atlantik zu bringen.
Verkehrsminister Sean Duffy verpackte den Schritt in eine rhetorische Offensive: „Verschwendung“ sei es, Geld in Windprojekte zu stecken, die besser für die maritime Industrie genutzt werden könnten. Doch hinter dieser Sprache steht ein Programm, das seit dem ersten Tag von Trumps zweiter Amtszeit konsequent durchgezogen wird: ein Feldzug gegen die erneuerbaren Energien. Schon am 20. Januar 2025, dem Tag seiner Vereidigung, verhängte Trump ein Moratorium auf alle neuen Offshore-Windgenehmigungen. Seit Wochen eskaliert die Regierung. Die Baustelle von Revolution Wind, einem sechs Milliarden Dollar schweren Großprojekt vor Rhode Island, wurde mit einem abrupten Baustopp belegt – obwohl es nahezu fertiggestellt war. Rhode Island und Connecticut protestierten scharf, bezeichneten den Schritt als rechtswidrig und warnten vor massiven Folgen für die Stromversorgung der Region. William Tong, Generalstaatsanwalt von Connecticut, kündigte umgehend Klage vor dem Bundesgericht in Massachusetts an: „Wir haben Milliarden investiert und ein Projekt, das kurz vor der Fertigstellung steht. Trumps irrationaler Stopp treibt die Strompreise hoch, vernichtet Arbeitsplätze und schwächt unser Netz.“

Der Kreuzzug gegen den Wind – Wie Trump Amerikas Energiewende sabotiert
Es sind 679 Millionen Dollar, die Amerikas Zukunft kosten könnten. Am Freitag kündigte das US-Verkehrsministerium an, ein ganzes Paket an Bundesmitteln zu streichen – Gelder, die für den Aufbau von Häfen und Terminals vorgesehen waren, um die Offshore-Windkraft voranzutreiben. 12 Projekte quer...