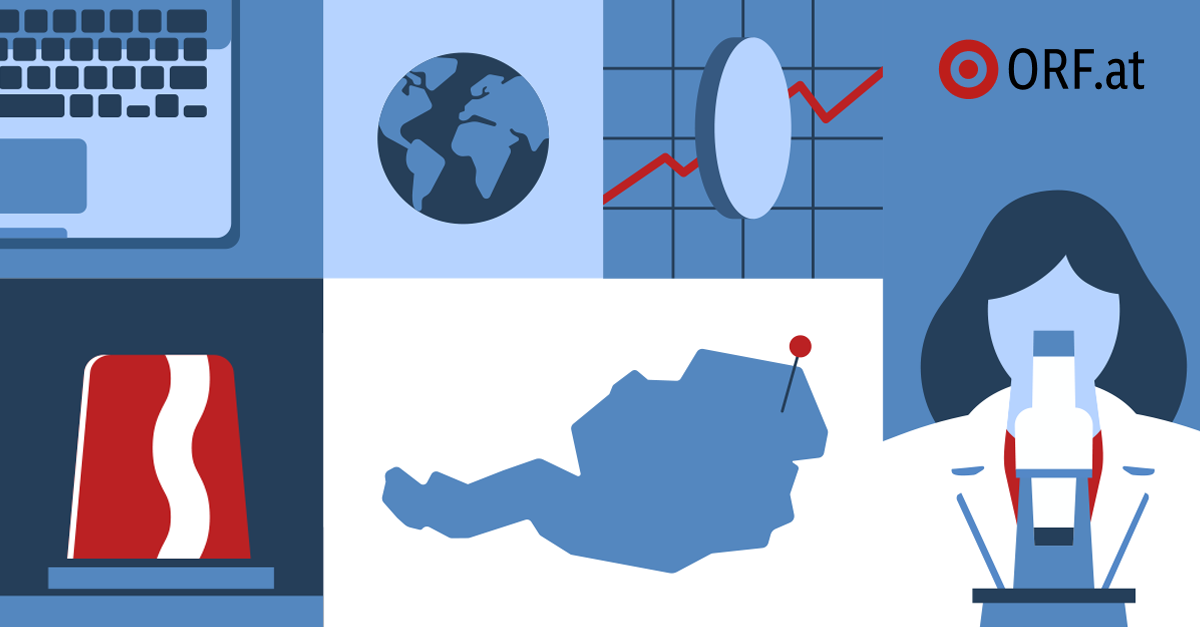USA greifen erneut ein – weitere Todesopfer nach Bootsangriff!
Southern Command bestätigte einen weiteren Angriff auf ein Boot, dem vier Menschen zum Opfer fielen. Es ist die 22. Operation dieser Art seit Beginn der Kampagne. Die Zahl der Toten steigt auf mindestens 87. Der Zeitpunkt ist brisant, weil der Kongress gerade die ersten Einsätze untersucht. Trotz wachsender Kritik hält die Regierung an der Strategie fest. Die Kombination aus Geheimhaltung, tödlicher Gewalt und unklarer Rechtsgrundlage bringt das Pentagon zunehmend in die Defensive – und lässt die Frage offen, was diese Kampagne wirklich bewirken soll. Beim ersten Einsatz, bei dem Überlebende nach einem zweiten Schlag getötet wurden, bestreitet Admiral Bradley einen Tötungsbefehl, doch Videoaufnahmen und seine Aussage vom 4. Dezember 2025 werfen schwerwiegende Fragen auf. Die hohen Opferzahlen und der Mangel an Transparenz lassen Kritik aus beiden Parteien wachsen. Die Regierung verteidigt den Kurs als notwendig im Kampf gegen Kartelle.
Southern Command bestätigte einen weiteren Angriff auf ein Boot, dem vier Menschen zum Opfer fielen. Es ist die 22. Operation dieser Art seit Beginn der Kampagne. Die Zahl der Toten steigt auf mindestens 87. Der Zeitpunkt ist brisant, weil der Kongress gerade die ersten Einsätze untersucht. Trotz wachsender Kritik hält die Regierung an der Strategie fest. Die Kombination aus Geheimhaltung, tödlicher Gewalt und unklarer Rechtsgrundlage bringt das Pentagon zunehmend in die Defensive – und lässt die Frage offen, was diese Kampagne wirklich bewirken soll. Beim ersten Einsatz, bei dem Überlebende nach einem zweiten Schlag getötet wurden, bestreitet Admiral Bradley einen Tötungsbefehl, doch Videoaufnahmen und seine Aussage vom 4. Dezember 2025 werfen schwerwiegende Fragen auf. Die hohen Opferzahlen und der Mangel an Transparenz lassen Kritik aus beiden Parteien wachsen. Die Regierung verteidigt den Kurs als notwendig im Kampf gegen Kartelle.
Southern Command bestätigte einen weiteren Angriff auf ein Boot, dem vier Menschen zum Opfer fielen. Es ist die 22. Operation dieser Art seit Beginn der Kampagne. Die Zahl der Toten steigt auf mindestens 87. Der Zeitpunkt ist brisant, weil der Kongress gerade die ersten Einsätze untersucht. Trotz wachsender Kritik hält die Regierung an der Strategie fest. Die Kombination aus Geheimhaltung, tödlicher Gewalt und unklarer Rechtsgrundlage bringt das Pentagon zunehmend in die Defensive – und lässt die Frage offen, was diese Kampagne wirklich bewirken soll. Beim ersten Einsatz, bei dem Überlebende nach einem zweiten Schlag getötet wurden, bestreitet Admiral Bradley einen Tötungsbefehl, doch Videoaufnahmen und seine Aussage vom 4. Dezember 2025 werfen schwerwiegende Fragen auf. Die hohen Opferzahlen und der Mangel an Transparenz lassen Kritik aus beiden Parteien wachsen. Die Regierung verteidigt den Kurs als notwendig im Kampf gegen Kartelle.
Southern Command bestätigte einen weiteren Angriff auf ein Boot, dem vier Menschen zum Opfer fielen. Es ist die 22. Operation dieser Art seit Beginn der Kampagne. Die Zahl der Toten steigt auf mindestens 87. Der Zeitpunkt ist brisant, weil der Kongress gerade die ersten Einsätze untersucht. Trotz wachsender Kritik hält die Regierung an der Strategie fest. Die Kombination aus Geheimhaltung, tödlicher Gewalt und unklarer Rechtsgrundlage bringt das Pentagon zunehmend in die Defensive – und lässt die Frage offen, was diese Kampagne wirklich bewirken soll. Beim ersten Einsatz, bei dem Überlebende nach einem zweiten Schlag getötet wurden, bestreitet Admiral Bradley einen Tötungsbefehl, doch Videoaufnahmen und seine Aussage vom 4. Dezember 2025 werfen schwerwiegende Fragen auf. Die hohen Opferzahlen und der Mangel an Transparenz lassen Kritik aus beiden Parteien wachsen. Die Regierung verteidigt den Kurs als notwendig im Kampf gegen Kartelle.