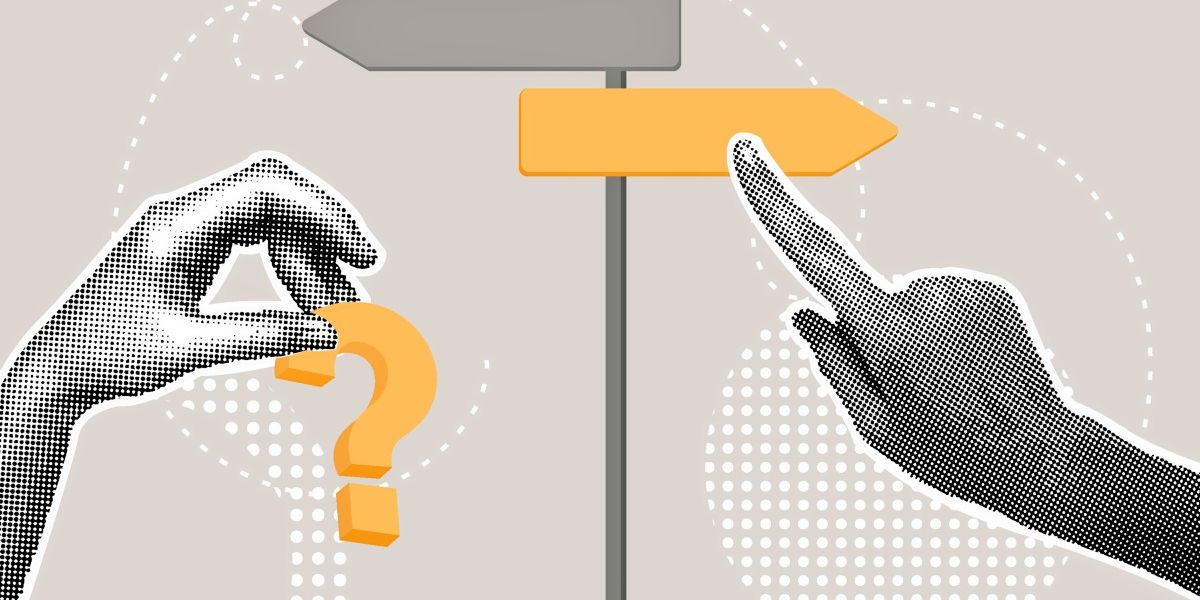Nius, Exxpress, rechte Meinungsmacher: Das ist das Netzwerk von Sebastian Kurz
Seit seinem Rückzug aus der Politik ist Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Teil eines internationalen Netzwerks aus Investoren, Medien und Politikern. Dabei pflegt er seine Nähe zu rechten Meinungsmachern. Im Geflecht befinden sich alte ÖVP-Vertraute, ein CDU-naher Multimillionär, rechte Onlinemedien und Viktor Orbán. Das gemeinsame Ziel: Die politische Debatte radikalisieren und weiter nach rechts verschieben.
Der berufliche Fokus von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich seit seinem Ausscheiden aus der Politik mehrmals verschoben. Er investierte in Start-ups (etwa in eine österreichische Pflegeplattform) und trat als Berater auf – unter anderem für den Tech-Milliardär Peter Thiel. Der ist Gründer von PayPal, gehörte zu den wichtigsten Unterstützern von Donald Trump im US-Wahlkampf, kritisiert ganz offen das Frauenwahlrecht und findet, dass Freiheit und Demokratie nur schwer miteinander vereinbar sind.
Heute arbeitet Kurz zwar nicht mehr für Thiel, der Kontakt scheint jedoch geblieben zu sein – zumindest haben sie sich beim Sommerfest von Ungarns Premierminister Viktor Orbán im Juli 2025 getroffen. Dazu später mehr.
2022 gründete Sebastian Kurz mit Gerd Alexander Schütz die Investmentgesellschaft AS2K GmbH. Schütz zählt laut dem Wirtschaftsmagazin Trend zu den 100 reichsten Österreichern. Er ist nicht nur Investor, sondern auch früherer ÖVP-Großspender.
Eine weitere unternehmerische Tätigkeit von Kurz: Dream Security, ein Cybersicherheit-Unternehmen mit Sitz in Tel Aviv, Israel, das Kurz mitgegründet hat. Kurz ist im Unternehmen „Präsident” und hält 15 Prozent der Anteile. Weiterer Gründer von Dream Security ist Shalev Hulio, früherer CEO der umstrittenen NSO Group. Deren Spionage-Software Pegasus sorgte weltweit für Schlagzeilen, nachdem bekannt wurde, dass sie nicht nur gegen Terroristen und Schwerverbrecher eingesetzt worden war, sondern auch gegen Journalist:innen, Richter:innen und oppositionelle Politiker:innen in mehreren Ländern – darunter auch EU-Staaten.

 kontrast.at
kontrast.at
Seit seinem Rückzug aus der Politik ist Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Teil eines internationalen Netzwerks aus Investoren, Medien und Politikern. Dabei pflegt er seine Nähe zu rechten Meinungsmachern. Im Geflecht befinden sich alte ÖVP-Vertraute, ein CDU-naher Multimillionär, rechte Onlinemedien und Viktor Orbán. Das gemeinsame Ziel: Die politische Debatte radikalisieren und weiter nach rechts verschieben.
Der berufliche Fokus von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich seit seinem Ausscheiden aus der Politik mehrmals verschoben. Er investierte in Start-ups (etwa in eine österreichische Pflegeplattform) und trat als Berater auf – unter anderem für den Tech-Milliardär Peter Thiel. Der ist Gründer von PayPal, gehörte zu den wichtigsten Unterstützern von Donald Trump im US-Wahlkampf, kritisiert ganz offen das Frauenwahlrecht und findet, dass Freiheit und Demokratie nur schwer miteinander vereinbar sind.
Heute arbeitet Kurz zwar nicht mehr für Thiel, der Kontakt scheint jedoch geblieben zu sein – zumindest haben sie sich beim Sommerfest von Ungarns Premierminister Viktor Orbán im Juli 2025 getroffen. Dazu später mehr.
2022 gründete Sebastian Kurz mit Gerd Alexander Schütz die Investmentgesellschaft AS2K GmbH. Schütz zählt laut dem Wirtschaftsmagazin Trend zu den 100 reichsten Österreichern. Er ist nicht nur Investor, sondern auch früherer ÖVP-Großspender.
Eine weitere unternehmerische Tätigkeit von Kurz: Dream Security, ein Cybersicherheit-Unternehmen mit Sitz in Tel Aviv, Israel, das Kurz mitgegründet hat. Kurz ist im Unternehmen „Präsident” und hält 15 Prozent der Anteile. Weiterer Gründer von Dream Security ist Shalev Hulio, früherer CEO der umstrittenen NSO Group. Deren Spionage-Software Pegasus sorgte weltweit für Schlagzeilen, nachdem bekannt wurde, dass sie nicht nur gegen Terroristen und Schwerverbrecher eingesetzt worden war, sondern auch gegen Journalist:innen, Richter:innen und oppositionelle Politiker:innen in mehreren Ländern – darunter auch EU-Staaten.

Nius, Exxpress, rechte Meinungsmacher: Das ist das Netzwerk von Sebastian Kurz
Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist Teil eines internationalen Netzwerks, das die politische Debatte nach rechts verschieben will.