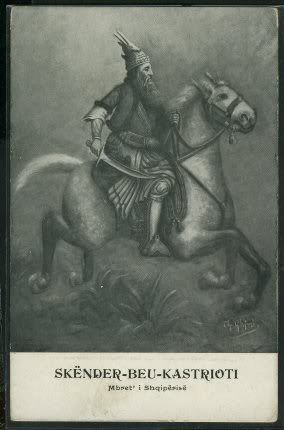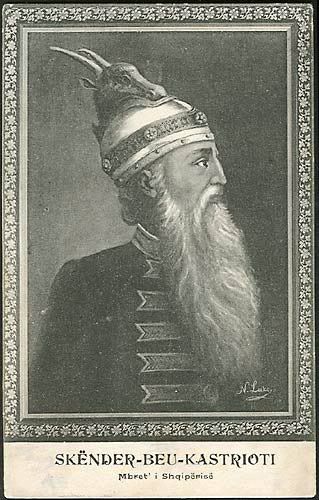Südslawe
Gesperrt
Sveti Sava (1175-1236) - Gründer der serbisch-orthodoxen Kirche:

Der Heilige Sava von Serbien (deutsch auch Sawa geschrieben) war Heiliger der christlichen Orthodoxie, bedeutender serbischer Aufklärer, erster orthodoxer Erzbischof von Serbien und Verfasser des ersten bürgerlichen Gesetzbuches auf dem europäischen Festland.
Sein weltlicher Name war Rastko (Nemanjić). Er wurde um 1175 in Ras, der damaligen Hauptstadt Serbiens nahe des heutigen Novi Pazar geboren. Gestorben ist er 1236 in Weliko Tarnowo, der Hauptstadt des Zweiten Bulgarischen Reiches. Er war der jüngste Sohn des serbischen Großžupan Stefan Nemanja. Sein ältester Bruder Vukan war Župan von Montenegro und Dalmatien, sein zweiter Bruder Stefan serbischer Großžupan und ab 1217 serbischer König.
Sava wurde mit 15 Jahren Župan von Hum (Herzegowina), ging aber mit 16 Jahren in das Athos-Kloster Panteleimon (Russiko) in Griechenland und danach in das Kloster Vatoped, wo er Mönch wurde. 1208 kehrte Sava nach Serbien zurück, um den Bürgerkrieg zwischen seinen Brüdern Stefan und Vukan zu beenden. Anschließend leistete er bedeutende Aufklärungsarbeit im damaligen Serbien. Im Jahr 1217 reiste Sava wieder nach Athos zurück.
1219 wurde Sava erster orthodoxer Erzbischof von Serbien, 1221 krönte er seinen Bruder Stefan zum König. Sava blieb bis 1233 Erzbischof, dann übergab er das Amt an seinen Schüler Arsenije von Srem (Syrmien). Auf der Rückkehr von seiner zweiten Pilgerfahrt nach Jerusalem verstarb Sava am 14. Januar 1236 in Weliko Tarnowo. Seine Gebeine wurden in der dortigen Kirche der 40 Märtyrer beigesetzt. 1237 wurden diese ins Kloster Milesevo verlegt. Bis zum Jahre 1594 galten seine Gebeine als Heilwirkend und seine letzte Ruhestätte war somit ein Wallfahrtsort für Serben und andere Christen. Aus Strafe für die sich wiederholenden Revolten der Serben gegen die osmanischen Besatzer wurden seine Gebeine nach Belgrad gebracht und vor den Augen der Bürger auf dem Hügel "Vracar" verbrannt. An dieser Stelle steht heute die größte orthodoxe Kathedrale der Welt, die Kathedrale des heiligen Sava (serb. Hram Svetoga Save).
Savas bedeutendste Gründungen waren das Athos-Kloster Hilandar (gemeinsam mit seinem Vater Stefan Nemanja/Mönch Symeon), das Kloster Žiča in Serbien (bis 1253 Sitz des orthodoxen Erzbischofs), das Erzengel-Kloster bei Jerusalem (heute nicht mehr existierend), sowie ein Hospital für orthodoxe Pilger in Akkon (auch nicht mehr existierend).
Seine bedeutendsten geschriebenen Werke waren die Viten für seinen verstorbenen Vater Stefan Nemanja-Symeon, das Typikon, die Klosterregeln für das Athos-Kloster Hilandar, und 1217 das Nomokanon, das erste geschriebene serbische bürgerliche Gesetzbuch und somit das älteste auf Festlandseuropa.
Hier die Kirche in Belgrad die nach ihm benannt wurde:

Osmanen verbrannten seinen Körper:

Altes Porträit des Heiligen Savas:

Sveti Sava nach Gründung der ersten Serbischen Kirche:

Sveti Sava vereint seine zerstrittenen Brüder:

Der heilige Sveti Sava(Gründer der serbisch-orthodoxen Kirche) wird 1595 auf dem Berg Vracar(Belgrad) von den Osmanen(Türken) verbrannt

Auf der gleichen Stelle steht heute zu ehren Savas die grösste orthodoxe Kirche der Welt nach ihm benannt - Der Hram Sv.Save.


Der Heilige Sava von Serbien (deutsch auch Sawa geschrieben) war Heiliger der christlichen Orthodoxie, bedeutender serbischer Aufklärer, erster orthodoxer Erzbischof von Serbien und Verfasser des ersten bürgerlichen Gesetzbuches auf dem europäischen Festland.
Sein weltlicher Name war Rastko (Nemanjić). Er wurde um 1175 in Ras, der damaligen Hauptstadt Serbiens nahe des heutigen Novi Pazar geboren. Gestorben ist er 1236 in Weliko Tarnowo, der Hauptstadt des Zweiten Bulgarischen Reiches. Er war der jüngste Sohn des serbischen Großžupan Stefan Nemanja. Sein ältester Bruder Vukan war Župan von Montenegro und Dalmatien, sein zweiter Bruder Stefan serbischer Großžupan und ab 1217 serbischer König.
Sava wurde mit 15 Jahren Župan von Hum (Herzegowina), ging aber mit 16 Jahren in das Athos-Kloster Panteleimon (Russiko) in Griechenland und danach in das Kloster Vatoped, wo er Mönch wurde. 1208 kehrte Sava nach Serbien zurück, um den Bürgerkrieg zwischen seinen Brüdern Stefan und Vukan zu beenden. Anschließend leistete er bedeutende Aufklärungsarbeit im damaligen Serbien. Im Jahr 1217 reiste Sava wieder nach Athos zurück.
1219 wurde Sava erster orthodoxer Erzbischof von Serbien, 1221 krönte er seinen Bruder Stefan zum König. Sava blieb bis 1233 Erzbischof, dann übergab er das Amt an seinen Schüler Arsenije von Srem (Syrmien). Auf der Rückkehr von seiner zweiten Pilgerfahrt nach Jerusalem verstarb Sava am 14. Januar 1236 in Weliko Tarnowo. Seine Gebeine wurden in der dortigen Kirche der 40 Märtyrer beigesetzt. 1237 wurden diese ins Kloster Milesevo verlegt. Bis zum Jahre 1594 galten seine Gebeine als Heilwirkend und seine letzte Ruhestätte war somit ein Wallfahrtsort für Serben und andere Christen. Aus Strafe für die sich wiederholenden Revolten der Serben gegen die osmanischen Besatzer wurden seine Gebeine nach Belgrad gebracht und vor den Augen der Bürger auf dem Hügel "Vracar" verbrannt. An dieser Stelle steht heute die größte orthodoxe Kathedrale der Welt, die Kathedrale des heiligen Sava (serb. Hram Svetoga Save).
Savas bedeutendste Gründungen waren das Athos-Kloster Hilandar (gemeinsam mit seinem Vater Stefan Nemanja/Mönch Symeon), das Kloster Žiča in Serbien (bis 1253 Sitz des orthodoxen Erzbischofs), das Erzengel-Kloster bei Jerusalem (heute nicht mehr existierend), sowie ein Hospital für orthodoxe Pilger in Akkon (auch nicht mehr existierend).
Seine bedeutendsten geschriebenen Werke waren die Viten für seinen verstorbenen Vater Stefan Nemanja-Symeon, das Typikon, die Klosterregeln für das Athos-Kloster Hilandar, und 1217 das Nomokanon, das erste geschriebene serbische bürgerliche Gesetzbuch und somit das älteste auf Festlandseuropa.
Hier die Kirche in Belgrad die nach ihm benannt wurde:

Osmanen verbrannten seinen Körper:

Altes Porträit des Heiligen Savas:

Sveti Sava nach Gründung der ersten Serbischen Kirche:

Sveti Sava vereint seine zerstrittenen Brüder:

Der heilige Sveti Sava(Gründer der serbisch-orthodoxen Kirche) wird 1595 auf dem Berg Vracar(Belgrad) von den Osmanen(Türken) verbrannt

Auf der gleichen Stelle steht heute zu ehren Savas die grösste orthodoxe Kirche der Welt nach ihm benannt - Der Hram Sv.Save.

Zuletzt bearbeitet: