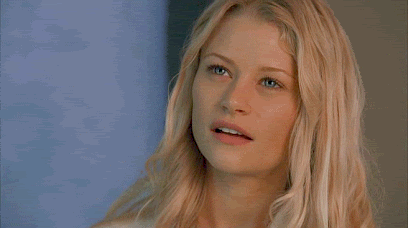N
Nik
Guest
Ein Plädoyer Altgriechisch ist eine tote Sprache – das braucht doch niemand?
Gerade bei Elternabenden in der Schule oder auch ganz normal im Alltag kommt diese Frage im Zusammenhang mit der humanistischen Schulbildung unvermeidlich in der einen oder anderen Art. Wir von Graecum.org möchten Ihnen nun als Überblick erläutern, warum das Erlernen des Altgriechischen niemals unnütz oder gar sinnlos ist, sondern schön und gut (καλός κἀγαθός). Sie können den Sinn darin erst entdecken, wenn Sie sich kurz damit beschäftigt haben – uralte Gedanken erschließen sich nunmal heutzutage nicht wie ein Statuspost auf Facebook.
Wir nehmen an…
Warum nun Altgriechisch lernen?
- Wissen und Bildung dienen nicht für Erlernung von Fähigkeiten von den Arbeitsmarkt, sondern auch zur Schulung von Charakter.
- Bildung muss den Ansprüchen der Ausbildung von Talenten und Charakter, den Ansprüchen der Schulung des freien, selbstständigen Denkens, aber auch den Ansprüchen der Kenntnis eines Lebens mit und in der eigenen Kultur genügen.
- Das Verständnis und der Umgang mit Sprachen und Kulturen muss dabei als eines der obersten Ziele festgelegt sein.
I. Altgriechisch ist eine tote Sprache…
…weil ihre Akmé schon längst vorüber ist. Sogar unter römischen Herrschaft, „zu einer Zeit also, als die griechische Kultur ihre produktive Kraft weitgehend eingebüßt hatte und von der Erinnerung an ihre große Vergangenheit zehrte [... ,war das Griechische] Kultursprache aller Gebildeten und Verkehrssprache in der gesamten östlichen Reichshälfte [...]. In dieser Form hieß sie „Koiné“, die Allgemeine. Sie war so allgemein, dass alles, was auf weite Verbreitung rechnete, in ihr verfasst sein musste, das Neue Testament genauso wie das oströmische, das byzantinische Recht. [...] Erst viel später, mit dem Aufkommen des Islam, [...] hat das Griechische seine Funktion als universelles Verständigungsmittel verloren.“ (Konrad Adam, Die alten Griechen, Berlin 2006, S. 23) Auch die deutsche Sprache wird einst den Weg alles Irdischen beschreiten müssen – wer würde es dann nicht zu erlernen suchen? Vielleicht nur um ein Gedicht von Schiller lesen zu können?
II. „Im Anfang war die Sprache“…
Die Griechen „waren die Ersten, die den Menschen als sprachbegabtes Lebewesen sahen. [... Der Begriff der Sprache] erinnert daran, dass Sprache sowohl Voraussetzung als auch Folge des Vernunftgebrauchs, des Denkens ist. [... Sprache] ist Bedingung für Kultur. Nicht jede Sprache allerdings in gleicher Weise. Das Griechische sticht da hervor, zunächst durch seinen übergroßen Formenreichtum, der es erlaubt, Beziehungen zwischen den einzelnen Satzgliedern viel genauer anzugeben als in jeder anderen europäischen Sprache. Das Gegenbeispiel ist das Englische, das ja vor allem deshalb zur modernen Weltsprache geworden ist, weil es aufs Konjugieren und Deklinieren weitgehend verzichtet. Es ist die Sprache für jedermann. Das Griechische bietet in dieser Hinsicht mehr [Medium, Optativ und die verschiedenen Aspekte einer Handlung!]. [...] Der Glaube, dass der Sprachgebrauch Gesetzen unterliegt, die sich erkennen und formulieren lassen, geht ebenso wie die Überzeugung, dass die Entschlüsselung dieser Gesetze dabei hilft, dem Wesen der Dinge auf die Spur zu kommen, auf die Griechen zurück. [...] Das emotionale Verhältnis der Griechen zu ihrer Sprache gründet weniger in deren Formenreichtum und Geschmeidigkeit, ihrer Präzision und Ausdruckskraft als auch und vor allem in ihrem Wohlklang. [...D]ie Kunst der Rede [...] dürfte niemals höher geschätzt worden sein und mehr bewirkt haben als im Athen des fünften vorchristlichen Jahrhunderts. [...] So wie die Modulationsfähigkeit des Griechischen die Entstehung aller denkbaren literarischen Formen begünstigt hat, kam ihre grammatische Struktur der Begriffsbildung und damit den Anfängen der Philosophie entgegen. Auch wer des Griechischen nicht mächtig ist, wird sich eine Vorstellung davon bilden können, wie der bestimmte Artikel, den diese Sprache dem Lateinischen voraus hat, dazu einlädt, sich das Allgemeine – das Sein, das Werden, das Vergehen – als etwas Bestimmtes vorzustellen und so den Glauben an eine zweite, geheimnisvolle Wirklichkeit zu nähren, die sich hinter der ersten, erfahrbaren verbirgt. Die Suche nach dieser zweiten, dem Denken [...] zugänglichen Welt begann mit Männern wie Thales und Anaximander, die man zusammen mit ein paar anderen nach ihrer Herkunft als ionische Naturphilosophen zu bezeichnen pflegt, und kam mit Platon und Aristoteles ans Ziel. [...] [Die griechische Sprache] steht am Anfang nicht nur ihrer eigenen, sondern der europäischen Kultur. Die wohl nicht weiß, was sie verliert, wenn sie von diesem Erbe nichts mehr hören will.“ (Konrad Adam, Die alten Griechen, Berlin 2006, S. 14ff.)
Was kann man nun daraus folgern?
Mit dem Erlernen des Griechischen schult man das Verständnis und vor allem den Umgang mit seiner eigenen Muttersprache. Man lernt um einiges besser und ausgeprägter die Grenzen, aber auch die Möglichkeiten der eigenen Sprache kennen. Daneben entwickelt man ein feines Gespür für die Rechtschreibung von Fremdwörtern und deren Aussprache, wie auch für die oftmals falsche Verwendung der Muttersprache in den Medien. Nach dem Erlernen der Sprache kann man Grundtexte der Weltliteratur, z.B. Homers Ilias lesen. Und dann darf man staunen (θαυμάζειν) was nach Aristoteles das Tor der Philosophie ist.
III. Wir leben in einer Demokratie…
und das verdanken wir den alten Griechen oder besser gesagt den Athenern. Sowohl Eltern als auch Lehrer beschweren sich immer öfter darüber, dass die eigenen Kinder zu wenig über das demokratische System Bescheid wissen und es nicht wirklich schätzen, geschweige denn ein Bewusstsein für Politik und die aktive Wahrnehmung ihrer Rechte entwickeln. Wie auch bei ein paar Stunden Sozialkunde innerhalb der Schulbildung? Die Texte zahlreicher Politiker, Redner, Philosophen und Historiker von damals bieten uns die Chance unsere eigene Gesellschaft zu verstehen, zu analysieren und zu kritisieren. Es gibt keinen Gedanken von damals, der heute nicht genauso aktuell ist. Die Beschäftigung mit den alten Schriften von herausragenden Denkern zeigt demnach die Entwicklung und die ursprünglichen Gedanken unserer Demokratie auf, sowie deren Grenzen.
IV. Freiheit…
in Denken und Handeln. Die einen nennen es Aufklärung, andere Emanzipation und manche Werte. Durch die Beschäftigung mit den zeitlosen Gedanken der Antike lernt man ganz von alleine den Begriff der Freiheit zu deuten und zu leben. Wer Griechisch lernt, hat die Chance, von der ersten Stunde an eine geistige Orientierung zu erwerben, die ihn ,,gegen gewisse Zeitkrankheiten immun macht: ein buchstäblich trostloses Nur-Spezialistenwissen, ein unkritisches Mitläufertum, den Bazillus der Unfreiheit, der in einer übervölkerten, technisch organisierten Welt epidemisch verbreitet ist.“ (Albert von Schirnding, Kinder, lernt Griechisch!, in: Ders., Menschwerdung. Aufsätze zur griechischen Literatur, hg. Von Franz-Peter Waiblinger, Ebenhausen bei München 2005, S. 163-165) An den Texten der Griechen lernt man logisches und kritisches Denken, aber auch dass Bindung Freiheit bedeutet. Kritik ist hierbei nichts unangenehmes – außer für die, die sie nicht zu verstehen wissen – ganz im Gegenteil, es ist die Basis griechischen Denkens: Nur im Dialog und im ständigen Hinterfragen findet man die Wahrheit mit größerer Wahrscheinlichkeit. Sokrates hat dies das Leben gekostet. Wie fest muss er an die Wahrheitsfähigkeit des Menschen geglaubt haben?
V. Zeitlos ins Leben…
mit der Zeit, die Bildung und Reife braucht. Das ist eine ideale Vorstellung, die in Zeiten des Bologna-Prozesses sichtbar immer schwieriger zu erreichen ist. Muße – ein Wort, das aus der Mode gekommen ist, da ihr Sinn nicht verstanden wird. So verhallen leider Sätze wie Bildung braucht Zeit ungehört. Was hat das nun mit Altgriechisch zu tun? Wenn dieses Fach ein Teil der gymnasialen Bildung ist, so wird einem zwar nicht das G8 erspart bleiben, aber dafür innerhalb der Griechisch-Stunden die Zeit etwas zurückgedreht. Man gelangt ganz automatisch zu Philosophischem und beschäftigt sich damit – 45 Minuten, die einem Schultag etwas Muße einräumen können, indem man diskutieren und nachdenken kann. Zeitlos sind darüber hinaus auch die Gedanken, mit denen man konfrontiert wird. Sie werden immer Gültigkeit besitzen, genau so wie ein Bach in der Musik. Und auch wenn man Bach nicht privat hört, ist er heute immer noch Orientierung für Musiker, was Struktur, Möglichkeiten und Komplexität der Musik anbelangt. Antike – gleich ob Kunst, Musik, Theater oder Sprache – ist der Maßstab und die Basis für Vieles, was danach kam. Back to the roots! Ad fontes!
VI. Phantasie und Naivität…
begründen unser Wissen. Ob Atomtheorie, Astronomie oder Chemie: Hätte es im 6. Jahrhundert v. Chr. nicht ein paar Menschen gegeben, die z.B. behauptet hätten, dass Wasser der Urstoff von allem ist oder ein paar hundert Jahre später, dass alles aus kleinen Teilchen mit Raum dazwischen besteht, würden wir heute überspitzt formuliert noch an Zeus glauben und Kant würde seine Kriegsbeute an der Wand bewundern. Phantasie und Naivität sind der Grundstein jeder unserer heutigen Wissenschaften. Nur dadurch, dass ein paar vollkommen verrückte Gedanken geäußert wurden und diese anschließend durch Diskussion weiterentwickelt hat, können wir heute in einem aufgeklärten Zeitalter leben. Die Deduktion – also die Entstehung einer Theorie, die rein auf logischem Denken basiert – war es, die zu all dem führte, eine Art des Erkenntnisgewinns, der heute fast gar nicht mehr praktiziert wird. Induktion mit all ihrer Empirie und ihren Versuchen ist das Zauberwort heutiger Wissenschaft.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt – Albert Einstein.
VII. Erkenne dich selbst! – Γνῶθι σεαυτόν.
Ins eigene Ich und Wir kann man durch verschiedene Arten gelangen. Ein Weg ist durch die Antike. Vieles von damals fand auf der ein oder anderen Weise Einzug in unsere Kultur und damit in unsere Identität als Mitglied einer Nation oder einer gesellschaftlichen Gruppe. Ob es die Gedanken eines Platon sind, die die meisten Philosophen bis heute zu eigenen Werken inspirieren oder ob es das Neue Testament ist, das ja nicht zufällig im Altgriechischen verfasst ist. Auf den Überresten des Areopag in Athen erinnert sogar noch eine Tafel mit der Rede des Paulus daran. Wer Griechisch lernt „lernt sich selbst verstehen – ein Vorgang, der das Gegenteil von Egozentrik bedeutet. Das in der frühen griechischen Dichtung und Philosophie aufbrechende Nachdenken des Menschen über den eigenen Stand zwischen Himmel und Erde mündet zugleich in Selbstbewusstsein und Selbstbescheidung: sich ermessend, vermessend, erfährt er seine Grenzen.“ (Albert von Schirnding, Kinder, lernt Griechisch!, in: Ders., Menschwerdung. Aufsätze zur griechischen Literatur, hg. Von Franz-Peter Waiblinger, Ebenhausen bei München 2005, S. 163-165) Eine Reise in die Antike ist immer eine Reise in die Anfänge europäischer Kultur und Denkens, und nicht zuletzt eine Reise zu Neuem. Wer seine eigene Kultur kennen gelernt hat, der kann erst andere schätzen lernen und ein wirkliches Interesse für andere Kontinente entwickeln, anstatt sich nur mit dem Touristenbus von einer Merchandising-Fabrik zur nächsten karren zu lassen.
Zu guter letzt:
Griechisch ist somit kein Problem, das die europäische Kultur zu lösen hätte, sondern eine einzigartige Chance, v.a. Jugendlichen das Wahre, Gute und Schöne zu vermitteln.
Gönnen wir uns und unseren Kindern diesen Luxus – in einer Konsumgesellschaft, die sich sonst jeden Luxus zu erlauben scheint? Altgriechisch hat auch einen Nutzen, denn erst dieses Wissen macht einen wirklich arbeitsmarkt- und gesellschaftsfähig, da es ein Wesentliches lehrt:
Sympathie (Συμπαθεῖν) – Mit-leiden oder besser Mit-Fühlen!
-
(####)