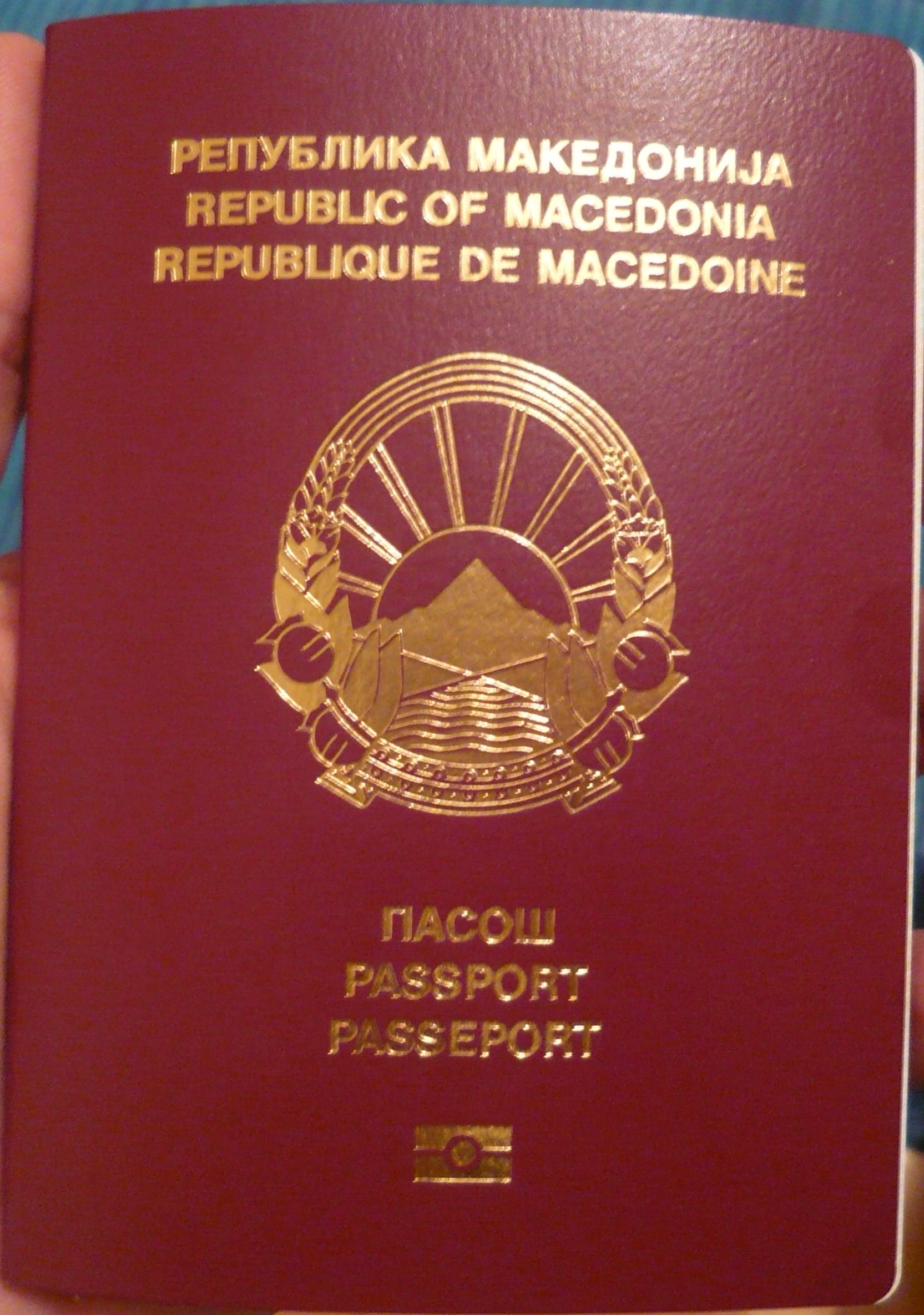Für dich Sonderschule Türke
Altertum (ca. 1400 v. Chr. bis 600 n. Chr.)

Der
Stern von Vergina war das
Emblem der
makedonischen Königsdynastie zur Zeit
Philipps II. und
Alexanders des Großen.
Die Antwort auf die Frage, wie „
griechisch“ die
antiken Makedonen waren, hat auch heute noch eine gewisse politische Brisanz. Die modernen Griechen erheben den Anspruch,
Alexander der Große und die übrigen Makedonen seien
Hellenen und Makedonien damals wie heute ein Teil Griechenlands gewesen, weshalb die Selbstbezeichnung des modernen, slawisch geprägten Staates
Mazedonien vielfach als Provokation empfunden wird.
Das Gebiet des späteren Makedoniens war bereits in der
Jungsteinzeit besiedelt. Einer Forschungsansicht zufolge sind die Makedonen gemeinsam mit den
Nordwestgriechen um 1200 v. Chr. in dieses Gebiet eingewandert und haben sich dort angesiedelt. Einige antike Historiker beschreiben die Makedonen hingegen als eine Mischbevölkerung aus
Phrygern,
Thrakern und
Illyrern, die nicht als ein griechischer Stamm eingewandert seien. Die momentan vorherrschende Forschungsmeinung sieht die Makedonen als nordgriechischen Stamm an, der sich zunächst aufgrund enger Kontakte zu Thrakern und Illyrern kulturell von den übrigen Griechen unterschied, doch wird dies nach wie vor von einer großen Minderheit bezweifelt, die darauf hinweist, dass die antiken Quellen die Makedonen einhellig
nicht als Griechen betrachteten, sondern als
Barbaren (
siehe unten).[SUP]
[1][/SUP]
Auch über die
makedonische Sprache gibt es unterschiedliche Auffassungen, denn die Quellenlage ist sehr unergiebig, und wahrscheinlich starb das Makedonische bereits während der Antike aus. Nach Auffassung des Linguisten
Otto Hoffmann (
Die Makedonen, 1906) ergibt sich aus dem Schriftmaterial, insbesondere den Personen-, Orts- und Monatsnamen, dass die makedonische Sprache bzw. der makedonische Dialekt
griechisch war. Diese Auffassung vertreten auch einige Sprach- und Geschichtswissenschaftler jüngerer Zeit (
Ivo Hajnal,
Hermann Bengtson,
Nicholas G. Hammond). Andere Sprachwissenschaftler sind der Ansicht, das Makedonische sei eine lediglich mit dem Griechischen verwandte Einzelsprache gewesen.
Am ehesten wird man die Makedonen vor
Alexander I. daher vielleicht als „Halbgriechen“ bezeichnen können, auch wenn, wie erwähnt, heute viele Experten (etwa
Hans-Ulrich Wiemer) überzeugt sind, dass sie Griechen gewesen seien, denen insbesondere in den
athenischen Quellen (vor allem bei
Demosthenes) aus politischen Gründen ihr Hellenentum bewusst abgesprochen worden sei.
Vor dem 19. Jahrhundert gab es niemals einen griechischen Nationalstaat, sondern die durch gemeinsame Kultur, Religion und Sprache verbundene Gemeinschaft der griechischen Klein- und Stadtstaaten. Von besonderer Bedeutung war die Teilnahme von Angehörigen des makedonischen Königshauses an den
Olympischen Spielen, die in klassischer Zeit nur Griechen gestattet war. Sie ist erstmals für König Alexander I. bezeugt, der um 500 v. Chr., noch vor seinem Regierungsantritt, als junger Mann in
Olympia zugelassen wurde, da er die dortigen Priester überzeugen konnte, er sei ein Nachfahre von
Herakles und
Achilleus und daher ein Grieche.[SUP]
[2][/SUP] 408 v. Chr. siegte das Viergespann des makedonischen Königs
Archelaos I. im olympischen Wagenrennen. Diese Anerkennung des Griechentums bezog sich aber ausschließlich auf die Königsfamilie, nicht auf die Makedonen als Volk, die von den übrigen Hellenen, wie gesagt, gewöhnlich nicht als Griechen, sondern als „
Barbaren“ (Nicht-Griechen) betrachtet wurden. Eine wichtige Quelle hierfür ist die Rede an den Makedonenkönig
Philipp II., die der Athener
Isokrates im Jahr 346 veröffentlichte und dem Herrscher übersandte. Darin erklärt er, Philipps Vorfahren hätten als Griechen die Herrschaft über ein nichtgriechisches Volk, die Makedonen, errungen; für dieses barbarische Volk sei eine Monarchie angemessen, von Griechen hingegen werde diese Herrschaftsform grundsätzlich nicht ertragen, denn Barbaren müsse man zwingen, Griechen hingegen überreden.[SUP]
[3][/SUP]
 Philipp II.
Philipp II., König Makedoniens (359–336 v. Chr.)

Das Makedonische Reich unter Philipp II.
Den Grundstein zur Großmachtstellung legte König Archelaos I. (413–399 v. Chr.). Unter seiner Herrschaft zog es viele griechische Gelehrte und Künstler an seinen Hof. Ein weiterer König war
Perdikkas II., ein Zeitgenosse des Thrakerkönigs
Sitalkes. Zur führenden Macht im antiken Griechenland wurde Makedonien binnen weniger Jahre jedoch erst ab 356 v. Chr. durch König Philipp II. Er konnte Ober- und Niedermakedonien erstmals fest miteinander verbinden, organisierte das Heer neu und begann, den makedonischen Einflussbereich durch Eroberungen und Unterwerfungen auszuweiten. Die Ausweitung des makedonischen Herrschaftsbereichs unter Philipp II. brachte das Königreich Makedonien in einen Konflikt mit
Athen, welches seine Interessen in Makedonien (Erzbergbau am
Pangeo-Gebirge, Siedlungen und Handelsstützpunkte auf der
Chalkidiki) gefährdet sah. Erschwerend kam hinzu, dass die Vorgänger von Philipp II. im
Peloponnesischen Krieg von 431 bis 404 v. Chr. mit dem athenischen Kriegsgegner
Sparta teilweise koaliert hatten. Das Königreich Makedonien war allerdings nicht unumstrittener Herrscher in Makedonien. Der
Chalkidikische Bund, ein Städtebund unter der Führung der Stadt
Olynth, konnte Anteile von Makedonien (
Anthemoundas-Tal am
Thermaischen Golf und
Mygdonia) für sich einnehmen und bedrohte zeitweilig sogar
Pella, ohne dieses allerdings belagern oder angreifen zu können. Philipp II. führte aufgrund dieser Interessenkonflikte eine vorsichtige und taktierende Außenpolitik mit zum Teil wechselnden Bündnissen, welche im Endeffekt ihm eine Konsolidierung und nachfolgend Ausdehnung seines Machtbereichs erlaubten. Der Konflikt mit Athen wurde mit der Einnahme von
Amphipolis östlich des erzführenden Pangeo-Gebirges durch makedonische Truppen unter Philipp II. mehr als offensichtlich. Die Versuche Athens, vor allem des Politikers (Demagogen)
Demosthenes, im Konflikt des
zweiten Olynthischen Kriegs 350 bis 348 v. Chr. zugunsten von Makedoniens Gegner, dem Chalkidikischen Bund unter der Führung von Olynth, einzugreifen, waren unzureichend und zu spät. Philipp II. zerstörte 348 v. Chr. Olynth, löste den Chalkidikischen Bund auf und hatte hiernach „den Rücken für eine Auseinandersetzung mit den griechischen Stadtstaaten frei.“
Wiederum eröffnete Philipp II. nicht direkt einen Feldzug gegen die griechischen Stadtstaaten, sondern verschaffte sich mit seinem Eingreifen in den
dritten heiligen Krieg der
delphischen Amphyktionie, eines religiösen Bundes der griechischen Stadtstaaten, Respekt und Anerkennung sowie einen Sitz im Rat der Amphyktionie. Den Sitz im Amphyktionenrat mit zwei Stimmen erhielt er für sich persönlich aufgrund seiner Verdienste, nicht als Vertreter der Makedonen, die weiterhin im Unterschied zu ihrer Königsfamilie nicht als Griechen anerkannt waren.[SUP]
[4][/SUP] Trotz dieser Integration Philipps als „Grieche“ blieben die Spannungen zwischen ihm und Athen sowie den anderen griechischen Stadtstaaten, teilweise mit der Ausnahme von
Theben, bestehen. Unter athenischer Führung erhoben sich die griechischen Stadtstaaten gegen die drohende makedonische Hegemonie über das gesamte Gebiet von Griechenland, wurden jedoch 338 v. Chr. in der
Schlacht von Chaironeia von den Makedonen unter der Führung Philipps II. und seines Sohnes
Alexander besiegt.
Der Makedonenkönig vereinte nun die zersplitterten und meist zerstrittenen griechischen Stadtstaaten im
Korinthischen Bund auf der Basis eines
Allgemeinen Friedens und schuf damit erstmals in der Geschichte ein geeintes Griechenland, nur mit Ausnahme Spartas und der griechischen
Kolonien im westlichen
Mittelmeer. Ungeachtet dieser Einigung schrieb der Korinthische Bund die Heeresfolge der griechischen Stadtstaaten gegenüber Philipp II. und dem Königreich Makedonien fest, was zugleich Sinnbild der makedonischen Hegemonie über die griechischen Stadtstaaten war. An der damaligen makedonischen Nordgrenze eroberte Philipp II. die Landschaft
Lynkestis (entspricht der Region um die
Prespaseen).
Als seit spätestens 338 v. Chr. politisch dominante Macht in ganz Griechenland prägten die Makedonen die Bezeichnung „Makedonien“ zunächst für die sich bildende staatliche Struktur. Als Bezeichnung der Landschaft blieb auch
„Epeiros“ (griechisch: „Festland“) geläufig. Staatsform war die
Monarchie. Der
König wurde von der Heeresversammlung gewählt. Ausschlaggebend für die makedonischen (militärischen) Erfolge waren vor allem die Heeresreform Philipps II. mit der Einführung der makedonischen
Phalanx-Technik sowie der
Sarissa.

Der Feldzug
Alexanders des Großen
 Römische
Römische Provinzen unter
Trajan (117 n. Chr.)
Unter Philipps Sohn
Alexander dem Großen erreichte Makedonien den Höhepunkt seiner Macht und seine größte Ausdehnung. Unter dem Vorwand eines „Rachefeldzugs“ für den Persereinfall in Griechenland 170 Jahre zuvor führte er 334 v. Chr. ein gesamtgriechisches Heer nach
Kleinasien und besiegte in drei Schlachten – am
Granikos, bei
Issos und
Gaugamela – die
Perser vernichtend. Er eroberte nacheinander
Ägypten und das
Persische Kernland und dehnte sein Reich bis zum
Hindukusch und zum
Indus aus. Damit schuf er die Voraussetzung für die
Hellenisierung ganz
Vorderasiens. Nach Alexanders Tod im Jahr 323 v. Chr. in
Babylon zerfiel das Großreich unter den Kämpfen seiner Nachfolger, der
Diadochen. Aus dem Alexanderreich ging in Vorderasien die Herrschaft der
Seleukiden hervor und in Ägypten die der
Ptolemäer. Diese makedonische Dynastie sollte das Land am
Nil 300 Jahre regieren, bis zum Tod Königin
Kleopatras 30 v. Chr. Die Herrschaft der ebenfalls makedonischen Seleukiden war bereits 64 v. Chr. von
Pompeius beendet worden.
Das Königreich Makedonien selbst, das im Alexanderzug und in den blutigen Diadochenkriegen zahllose Männer eingebüßt hatte, verlor dagegen zunächst an Bedeutung, es kam zu Thronwirren. Im Jahre 280 v. Chr. marschierte dann im Rahmen der
Keltischen Südwanderung eine Armee von etwa 85.000
keltischen Kriegern nach Makedonien und Zentralgriechenland. Sie ließen sich jedoch, nachdem sie 277 von
Antigonos II. Gonatas besiegt worden waren, in Thrakien (
Tylis) und
Anatolien nieder (
Galater).[SUP]
[5][/SUP] Antigonos II. etablierte sich auf dem Thron, und die Dynastie der
Antigoniden konnte Makedonien noch einmal zur Vormacht über Hellas machen, ihr Machtbereich schrumpfte infolge dreier
Makedonisch-Römischer Kriege aber immer mehr zusammen: Der tatkräftige König
Philipp V. führte die ersten beiden dieser Kriege und büßte nach dem Ende des zweiten im Jahr 196 v. Chr. die Hegemonie über Griechenland ein. Sein Sohn und Nachfolger
Perseus war dann der letzte Makedonenkönig: 168 v. Chr. erzwang
Rom in einem überaus blutigen dritten Krieg das Ende des antigonidischen Königtums und die Aufteilung Makedoniens in vier formal selbständige Gebiete. Diese wiederum wurden 20 Jahre später als
Provinz Macedonia formal ins Römische Reich eingegliedert, das nun auch im östlichen Mittelmeerraum zur führenden Macht aufgestiegen war. Einiges spricht dafür, dass die meisten Makedonen während dieser Jahre entweder in den Kämpfen umkamen oder das Land verließen, um sich insbesondere in
Kleinasien niederzulassen. Nach Ausweis der (wenigen) Inschriften, die zwischen 168 und
Augustus in der Gegend gesetzt wurden, scheint zumindest die makedonische Sprache außer Gebrauch geraten zu sein, und mutmaßlich traten nun Menschen aus Thrakien, Illyrien und Griechenland an die Stelle der Makedonen. Über die Geschichte Makedoniens in dieser Zeit ist allerdings fast nichts Sicheres bekannt.
Seit der Errichtung des römischen Kaisertums durch Augustus erlebte das Gebiet einen gewissen Aufschwung. Bei der so genannten
Reichsteilung von 395 n. Chr. fiel das Land dann an das
Oströmische Reich, das kulturell und sprachlich griechisch geprägt war. Im 4. und 5. Jahrhundert fielen
Hunnen und
Goten in Makedonien ein, ließen sich dort jedoch nicht nieder. Mit den
Slawen- und Awareneinfällen im späten 6. Jahrhundert endete dann in dieser Region die
Spätantike.
Griechisch.