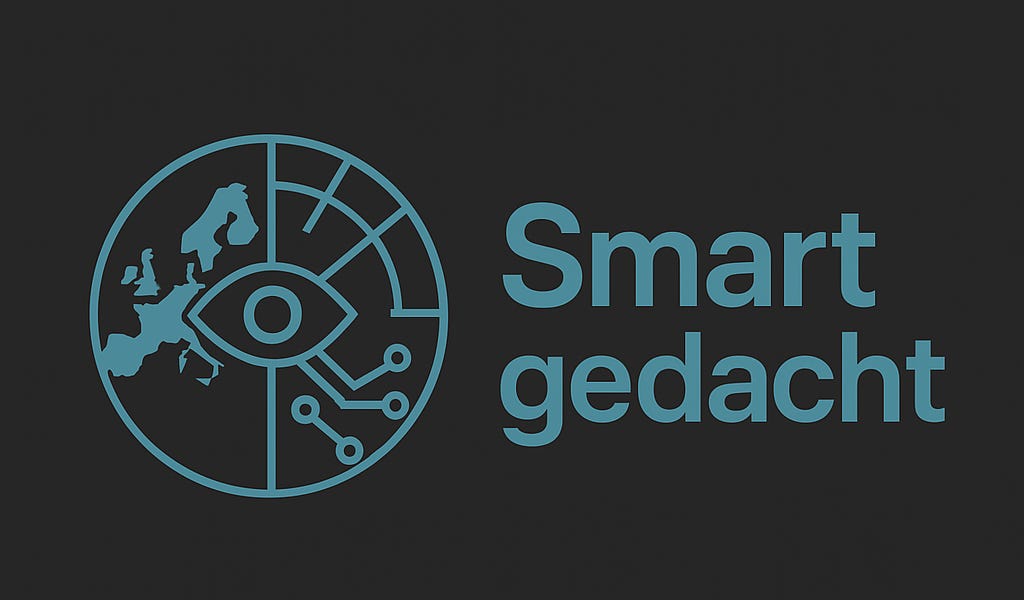Die Intellektuellenhasser
Wie die FPÖ systematisch gegen Bildung, Denken und Wissen mobil macht
Es ist kein Zufall, dass Bildung zur Zielscheibe wird. Wenn eine Partei wie die FPÖ systematisch gegen Intellektuelle, Wissenschaftlerinnen, Lehrer und Journalistinnen polemisiert, dann geschieht das nicht aus rhetorischem Übermut – es ist Teil einer bewussten Strategie. Ziel ist es, Vertrauen in alles zu erschüttern, was auf kritischem Denken beruht: Universitäten, Medien, Forschungseinrichtungen, Bildungssysteme.
Der Zweck ist klar: Wer misstraut, ist leichter manipulierbar.
Wer weniger weiß, stellt weniger Fragen.
Die FPÖ setzt seit Jahren auf eine populistische Rhetorik, in der Wissen als „links“, Nachdenken als „elitär“ und Bildung als „Umerziehung“ diffamiert wird.
Der oberste FPÖ Kampfprediger Herbert Kickl spricht von „Systemwissenschaftlern“, warnt vor „Gender-Ideologien“ an Schulen und bezeichnet Universitäten als Brutstätten des sogenannten Linksextremismus.
Es ist dieselbe Linie, mit der er auch den Journalismus delegitimiert – indem er die „Systempresse“ für die angebliche Manipulation der Bevölkerung verantwortlich macht. Der Angriff auf die freie Wissenschaft ist kein Nebenschauplatz, sondern zentrale Bühne einer Politik, die einfache Wahrheiten bevorzugt, weil sie komplexe Zusammenhänge nicht kontrollieren kann.
Wie die FPÖ systematisch gegen Bildung, Denken und Wissen mobil macht
Es ist kein Zufall, dass Bildung zur Zielscheibe wird. Wenn eine Partei wie die FPÖ systematisch gegen Intellektuelle, Wissenschaftlerinnen, Lehrer und Journalistinnen polemisiert, dann geschieht das nicht aus rhetorischem Übermut – es ist Teil einer bewussten Strategie. Ziel ist es, Vertrauen in alles zu erschüttern, was auf kritischem Denken beruht: Universitäten, Medien, Forschungseinrichtungen, Bildungssysteme.
Der Zweck ist klar: Wer misstraut, ist leichter manipulierbar.
Wer weniger weiß, stellt weniger Fragen.
Die FPÖ setzt seit Jahren auf eine populistische Rhetorik, in der Wissen als „links“, Nachdenken als „elitär“ und Bildung als „Umerziehung“ diffamiert wird.
Der oberste FPÖ Kampfprediger Herbert Kickl spricht von „Systemwissenschaftlern“, warnt vor „Gender-Ideologien“ an Schulen und bezeichnet Universitäten als Brutstätten des sogenannten Linksextremismus.
Es ist dieselbe Linie, mit der er auch den Journalismus delegitimiert – indem er die „Systempresse“ für die angebliche Manipulation der Bevölkerung verantwortlich macht. Der Angriff auf die freie Wissenschaft ist kein Nebenschauplatz, sondern zentrale Bühne einer Politik, die einfache Wahrheiten bevorzugt, weil sie komplexe Zusammenhänge nicht kontrollieren kann.