Wem gehört Jidova? Wissenschaft, Antisemitismus und nationale Identität
Juden, Tataren oder Riesen? Eine akademische Debatte in Rumänien im 19. Jahrhundert und ihre politischen Folgen
Andreea Kaltenbrunner zeichnet in diesem Gastblogbeitrag nach, wie sich eine wissenschaftliche Auseinandersetzung um den Ortsnamen "Jidova" zu einem Stellvertreterkonflikt über nationale Identität und jüdische Emanzipation im modernen Rumänien entwickelte.
Mit der Veröffentlichung der ersten geografischen Wörterbücher Rumäniens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde erstmals deutlich, dass es im Land mehrere Orte gab, deren Namen auf eine jüdische Vergangenheit hinzuweisen schienen: Jideni, Jidești, Jidoșița usw.1 Auffällig war dabei, dass die Mehrheit dieser Orte nicht in der Moldau lag, dem Zentrum jüdischen Lebens in Rumänien, sondern in der Walachei. Die Ortsnamen deuteten auf lange historische Kontakte hin – ein Befund, der dem nationalistischen Diskurs widersprach, welcher Juden meistens als rezente Migranten darstellte.
Die geografische Erschließung des Landes erfolgte im Kontext der Entstehung des Nationalstaats nach der Vereinigung der Moldau und der Walachei 1859. Sie stand zudem im Zusammenhang mit der ersten Verfassung Rumäniens 1866, die intensive Debatten über die Einbürgerung der jüdischen Bevölkerung auslöste. Während Juden im Verlauf des 19. Jahrhunderts in vielen westeuropäischen Ländern schrittweise Emanzipationsrechte erhielten, erwartete man auch von Rumänien – das nach dem Zarenreich, dem Habsburgerreich und Deutschland die drittgrößte jüdische Bevölkerung Europas aufwies und den Anspruch erhob, zu den modernen Nationalstaaten zu gehören, ähnliche Schritte.
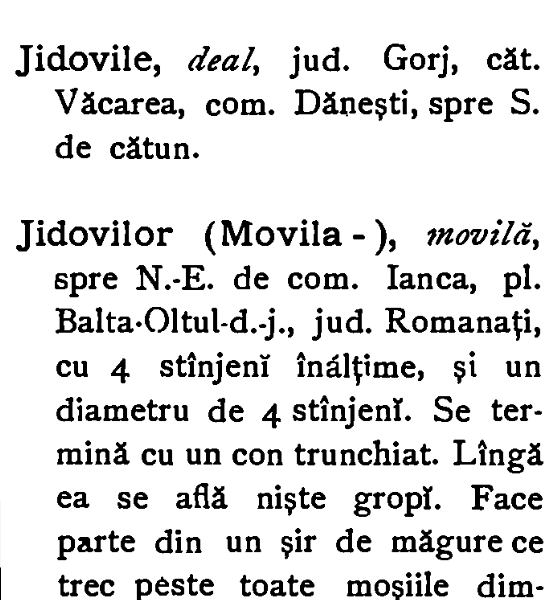
 www.derstandard.at
www.derstandard.at
Juden, Tataren oder Riesen? Eine akademische Debatte in Rumänien im 19. Jahrhundert und ihre politischen Folgen
Andreea Kaltenbrunner zeichnet in diesem Gastblogbeitrag nach, wie sich eine wissenschaftliche Auseinandersetzung um den Ortsnamen "Jidova" zu einem Stellvertreterkonflikt über nationale Identität und jüdische Emanzipation im modernen Rumänien entwickelte.
Mit der Veröffentlichung der ersten geografischen Wörterbücher Rumäniens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde erstmals deutlich, dass es im Land mehrere Orte gab, deren Namen auf eine jüdische Vergangenheit hinzuweisen schienen: Jideni, Jidești, Jidoșița usw.1 Auffällig war dabei, dass die Mehrheit dieser Orte nicht in der Moldau lag, dem Zentrum jüdischen Lebens in Rumänien, sondern in der Walachei. Die Ortsnamen deuteten auf lange historische Kontakte hin – ein Befund, der dem nationalistischen Diskurs widersprach, welcher Juden meistens als rezente Migranten darstellte.
Die geografische Erschließung des Landes erfolgte im Kontext der Entstehung des Nationalstaats nach der Vereinigung der Moldau und der Walachei 1859. Sie stand zudem im Zusammenhang mit der ersten Verfassung Rumäniens 1866, die intensive Debatten über die Einbürgerung der jüdischen Bevölkerung auslöste. Während Juden im Verlauf des 19. Jahrhunderts in vielen westeuropäischen Ländern schrittweise Emanzipationsrechte erhielten, erwartete man auch von Rumänien – das nach dem Zarenreich, dem Habsburgerreich und Deutschland die drittgrößte jüdische Bevölkerung Europas aufwies und den Anspruch erhob, zu den modernen Nationalstaaten zu gehören, ähnliche Schritte.
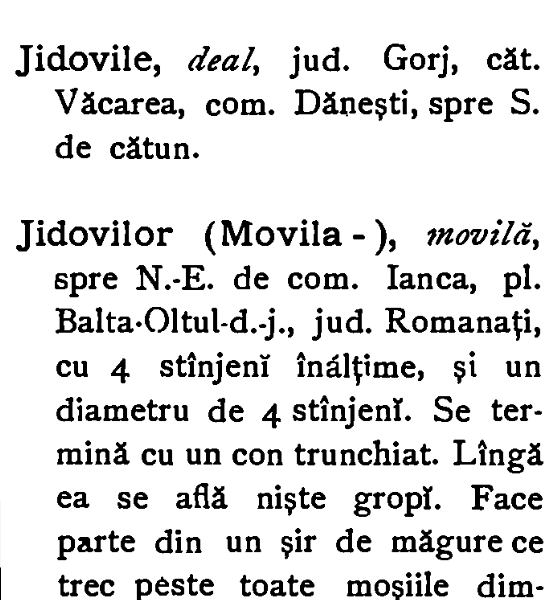
Wem gehört Jidova? Wissenschaft, Antisemitismus und nationale Identität
Juden, Tataren oder Riesen? Eine akademische Debatte in Rumänien im 19. Jahrhundert und ihre politischen Folgen

