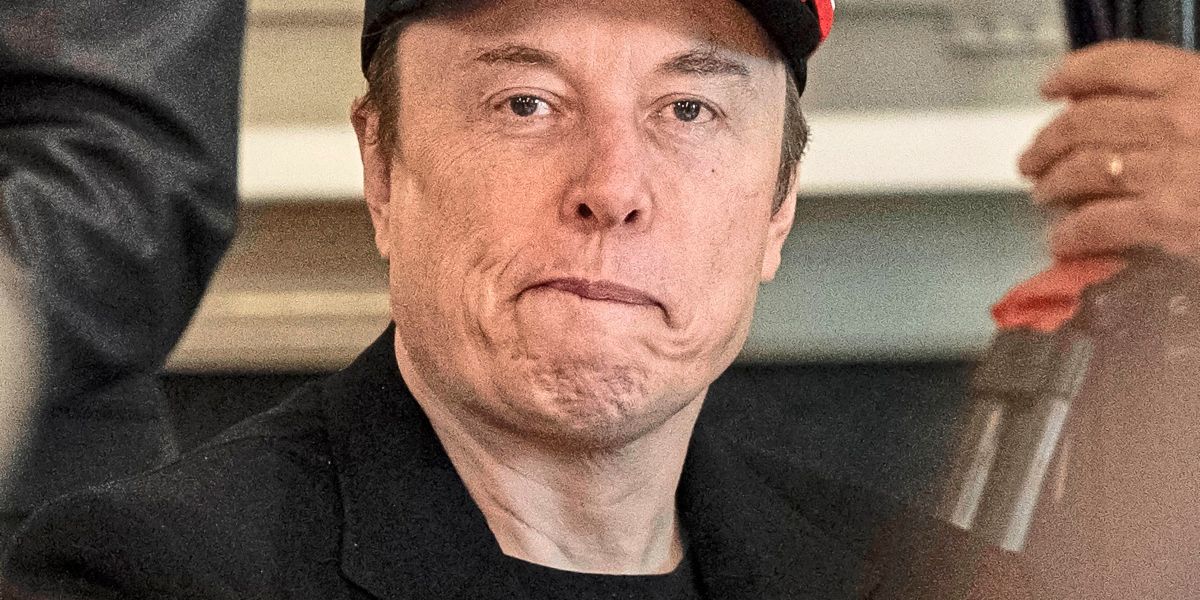Der taumelnde Riese – Trumps Politik und der fallende Dollar
Es war ein Höhenflug, der abrupt endete. Kurz nach Donald Trumps Wahl zum Präsidenten verzeichnete der US-Dollar einen kräftigen Anstieg – getrieben von Versprechen wirtschaftlicher Renaissance, Steuererleichterungen und Investitionen in Infrastruktur. Die Märkte reagierten mit Euphorie, der Dollar legte im Dezember und Januar kräftig zu. Doch ab dem Zeitpunkt seiner Vereidigung am 20. Januar begann die Ernüchterung. Der Kurs sackte langsam, aber stetig ab – und beschleunigte sich dramatisch nach der Verkündung der ersten Strafzölle am 2. April. Innerhalb weniger Monate verlor der US-Dollar-Index über 11 Prozentpunkte – von einem Plus von sechs auf ein Minus von über fünf Prozent.
Diese Entwicklung ist mehr als ein bloßer Ausschlag an den Währungsbörsen. Sie spiegelt ein schwindendes Vertrauen in die ökonomische Linie der USA unter Trump. Wer in einer globalisierten Welt Protektionismus predigt, zieht Kapital nicht an – er vertreibt es. Investoren fliehen aus Währungen, denen ein strategischer Kompass fehlt oder deren Führer mit Handelskriegen spielen wie mit Dominosteinen. Das Problem: Der Dollar ist nicht irgendeine Währung. Er ist Weltreserve, Maßstab, Vertrauensanker – oder war es zumindest. Für Anleger bedeutet der Kursverfall eine Zwickmühle. Ein schwacher Dollar kann Exporte beflügeln, US-Aktien attraktiver machen, Gold und Rohstoffe verteuern. Doch wer in den Dollar investiert, setzt auf Stabilität – nicht auf Spekulation. In einer solchen Phase lohnt sich die Wette nur, wenn man von einer baldigen Korrektur überzeugt ist.

 kaizen-blog.org
kaizen-blog.org
Es war ein Höhenflug, der abrupt endete. Kurz nach Donald Trumps Wahl zum Präsidenten verzeichnete der US-Dollar einen kräftigen Anstieg – getrieben von Versprechen wirtschaftlicher Renaissance, Steuererleichterungen und Investitionen in Infrastruktur. Die Märkte reagierten mit Euphorie, der Dollar legte im Dezember und Januar kräftig zu. Doch ab dem Zeitpunkt seiner Vereidigung am 20. Januar begann die Ernüchterung. Der Kurs sackte langsam, aber stetig ab – und beschleunigte sich dramatisch nach der Verkündung der ersten Strafzölle am 2. April. Innerhalb weniger Monate verlor der US-Dollar-Index über 11 Prozentpunkte – von einem Plus von sechs auf ein Minus von über fünf Prozent.
Diese Entwicklung ist mehr als ein bloßer Ausschlag an den Währungsbörsen. Sie spiegelt ein schwindendes Vertrauen in die ökonomische Linie der USA unter Trump. Wer in einer globalisierten Welt Protektionismus predigt, zieht Kapital nicht an – er vertreibt es. Investoren fliehen aus Währungen, denen ein strategischer Kompass fehlt oder deren Führer mit Handelskriegen spielen wie mit Dominosteinen. Das Problem: Der Dollar ist nicht irgendeine Währung. Er ist Weltreserve, Maßstab, Vertrauensanker – oder war es zumindest. Für Anleger bedeutet der Kursverfall eine Zwickmühle. Ein schwacher Dollar kann Exporte beflügeln, US-Aktien attraktiver machen, Gold und Rohstoffe verteuern. Doch wer in den Dollar investiert, setzt auf Stabilität – nicht auf Spekulation. In einer solchen Phase lohnt sich die Wette nur, wenn man von einer baldigen Korrektur überzeugt ist.

Der taumelnde Riese – Trumps Politik und der fallende Dollar
Es war ein Höhenflug, der abrupt endete. Kurz nach Donald Trumps Wahl zum Präsidenten verzeichnete der US-Dollar einen kräftigen Anstieg – getrieben von Versprechen wirtschaftlicher Renaissance, Steuererleichterungen und Investitionen in Infrastruktur.