Die große Lüge von Portland II – Trumps Drohung, Fox’ Bilder und die Wahrheit auf der Straße
Unter unserem Artikel „Die große Lüge von Portland – Wie Fox News Trump füttert und eine Stadt zum Feindbild macht“ auf https://kaizen-blog.org/die-grosse-...-fuettert-und-eine-stadt-zum-feindbild-macht/ hatten wir aufgedeckt, wie Donald Trump mit falschen Bildern gefüttert wurde – oder sie selbst ins Spiel brachte –, um seinen neuesten Vorstoß zu rechtfertigen: das Militär nach Portland zu schicken. Bereits in dem Fall Kilmar Abrego Garcia konnten wir unter „Die Faust, das Foto und die Lüge – Wie Trump das Recht mit einem irreführenden Bild ersetzt“ auf https://kaizen-blog.org/die-faust-d...-recht-mit-einem-irrefuehrenden-bild-ersetzt/ aufdecken, wie Trump ganze rechtliche Begründungen auf manipulierte Fotos stützt. Der Auslöser in Portland war eine reale, aber singuläre Szene: Am 1. September 2025 stellten Aktivisten eine symbolische Guillotine vor dem ICE-Gebäude auf, worauf Bundesbeamte sofort mit Tränengas reagierten. Fox News machte daraus einen Aufmacher, montierte Archivbilder aus den Jahren 2020 und 2021 hinzu und verwandelte einen isolierten Protestabend in ein vermeintliches Bürgerkriegsszenario. Ein Paradebeispiel für Manipulation: Kontext zerstört, Geschichte umgeschrieben, Angst geschürt. Trump übernahm die Erzählung – vielleicht aus Naivität, vielleicht aus Kalkül – und kündigte damals an, die Nationalgarde zu entsenden.
Tatsächlich ist Portland so ruhig wie seit Jahren nicht mehr. Vor dem grauen ICE-Gebäude am Stadtrand stehen an diesem Abend gerade einmal zwei Dutzend Demonstrierende. Einige tragen Helme, Gasmasken, schwarze Kleidung. Sie stehen an der blauen Linie, die quer über die Zufahrt gemalt ist, und beobachten die Beamten auf dem Dach. „GOVERNMENT PROPERTY – DO NOT BLOCK“ steht in weißen Buchstaben auf dem Asphalt. Wer zu lange in der Einfahrt verweilt, muss damit rechnen, dass Pfefferkugeln herabregnen. Gegen Mitternacht ist der Platz leer, niemand wurde verletzt. Und dennoch ist Portland wieder Symbolpolitik. Trump spricht von einer Stadt, in der „die Hölle los“ sei, und nutzt sie als Beweisstück für seine These vom angeblich kollabierenden Amerika. Schon im Sommer hatte er die Nationalgarde nach Los Angeles geschickt und in Washington, D.C., die Bundespolizei unter seine Kontrolle gebracht. Nun droht er Portland – ausgerechnet in einer Phase, in der die Kriminalität rückläufig ist. Laut dem aktuellen Bericht der Major Cities Chiefs Association ist die Zahl der Morde in Portland zwischen Januar und Juni um mehr als die Hälfte gesunken, ein Rückgang von 51 Prozent.
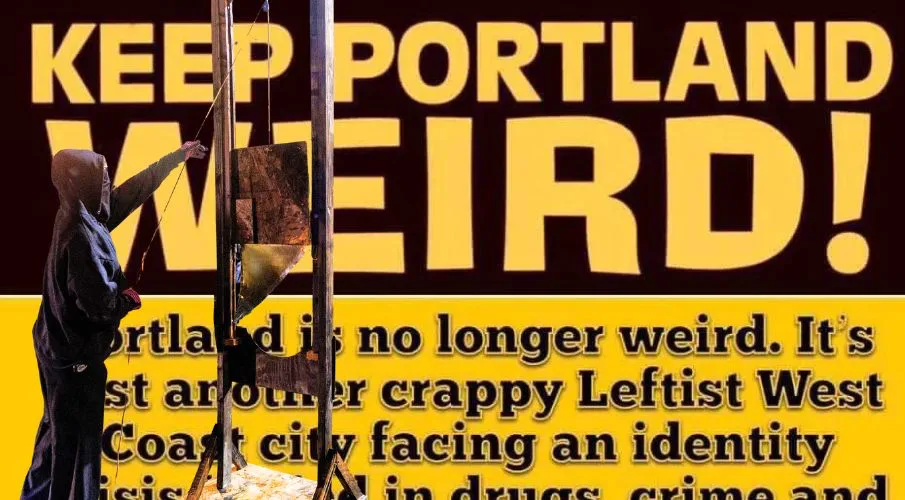
 kaizen-blog.org
kaizen-blog.org
Unter unserem Artikel „Die große Lüge von Portland – Wie Fox News Trump füttert und eine Stadt zum Feindbild macht“ auf https://kaizen-blog.org/die-grosse-...-fuettert-und-eine-stadt-zum-feindbild-macht/ hatten wir aufgedeckt, wie Donald Trump mit falschen Bildern gefüttert wurde – oder sie selbst ins Spiel brachte –, um seinen neuesten Vorstoß zu rechtfertigen: das Militär nach Portland zu schicken. Bereits in dem Fall Kilmar Abrego Garcia konnten wir unter „Die Faust, das Foto und die Lüge – Wie Trump das Recht mit einem irreführenden Bild ersetzt“ auf https://kaizen-blog.org/die-faust-d...-recht-mit-einem-irrefuehrenden-bild-ersetzt/ aufdecken, wie Trump ganze rechtliche Begründungen auf manipulierte Fotos stützt. Der Auslöser in Portland war eine reale, aber singuläre Szene: Am 1. September 2025 stellten Aktivisten eine symbolische Guillotine vor dem ICE-Gebäude auf, worauf Bundesbeamte sofort mit Tränengas reagierten. Fox News machte daraus einen Aufmacher, montierte Archivbilder aus den Jahren 2020 und 2021 hinzu und verwandelte einen isolierten Protestabend in ein vermeintliches Bürgerkriegsszenario. Ein Paradebeispiel für Manipulation: Kontext zerstört, Geschichte umgeschrieben, Angst geschürt. Trump übernahm die Erzählung – vielleicht aus Naivität, vielleicht aus Kalkül – und kündigte damals an, die Nationalgarde zu entsenden.
Tatsächlich ist Portland so ruhig wie seit Jahren nicht mehr. Vor dem grauen ICE-Gebäude am Stadtrand stehen an diesem Abend gerade einmal zwei Dutzend Demonstrierende. Einige tragen Helme, Gasmasken, schwarze Kleidung. Sie stehen an der blauen Linie, die quer über die Zufahrt gemalt ist, und beobachten die Beamten auf dem Dach. „GOVERNMENT PROPERTY – DO NOT BLOCK“ steht in weißen Buchstaben auf dem Asphalt. Wer zu lange in der Einfahrt verweilt, muss damit rechnen, dass Pfefferkugeln herabregnen. Gegen Mitternacht ist der Platz leer, niemand wurde verletzt. Und dennoch ist Portland wieder Symbolpolitik. Trump spricht von einer Stadt, in der „die Hölle los“ sei, und nutzt sie als Beweisstück für seine These vom angeblich kollabierenden Amerika. Schon im Sommer hatte er die Nationalgarde nach Los Angeles geschickt und in Washington, D.C., die Bundespolizei unter seine Kontrolle gebracht. Nun droht er Portland – ausgerechnet in einer Phase, in der die Kriminalität rückläufig ist. Laut dem aktuellen Bericht der Major Cities Chiefs Association ist die Zahl der Morde in Portland zwischen Januar und Juni um mehr als die Hälfte gesunken, ein Rückgang von 51 Prozent.
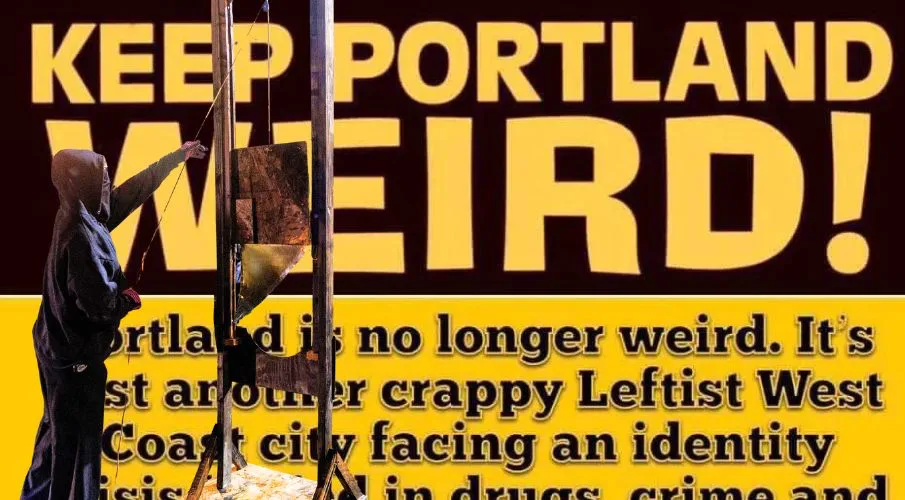
Die große Lüge von Portland II – Trumps Drohung, Fox’ Bilder und die Wahrheit auf der Straße
Unter unserem Artikel „Die große Lüge von Portland – Wie Fox News Trump füttert und eine Stadt zum Feindbild macht“ auf https://kaizen-blog.org/die-grosse-luege-von-portland-wie-fox-news-trump-fuettert-und-eine-stadt-zum-feindbild-macht/ hatten wir aufgedeckt, wie Donald Trump mit falschen...



