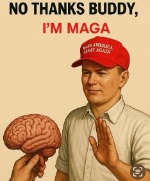Warum das EU-Budget nicht überambitioniert ist
Für einen Kompromiss müssen alle Beteiligten über ihren Schatten springen. Dass die nationalen Beiträge nicht steigen sollen, könnte ein gutes Argument in den einzelnen Mitgliedsstaaten sein
Paul Schmidt, der Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, geht in seinem Gastkommentar auf den Streit über das EU-Budget ein, das bei vielen auf Kritik gestoßen ist.
Der neue EU-Haushaltsplan für die Jahre 2028 bis 2034 sorgt seit seiner Präsentation für gehörig Aufregung. Der Entwurf, den Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als "größer, intelligenter und schlagkräftiger als seine Vorgänger" beschreibt, soll den geänderten geopolitischen Realitäten Rechnung tragen, strategischer und flexibler ausgestaltet sein. Der Beifall zum neuen europäischen Zahlenwerk hält sich trotzdem in Grenzen.
Zweitausend Milliarden Euro sollen der Union in der nächsten siebenjährigen Finanzperiode zur Verfügung stehen. Das klingt nach viel, ist auch deutlich mehr als zuletzt, und doch entspricht es lediglich 1,26 Prozent des EU-Bruttonationaleinkommens. Angesichts der aktuellen Problemlagen, der weiter steigenden Erwartungen an "Europa" sowie einer sich immer rauer gebärdenden globalen Umgebung ist der Vorschlag jedenfalls alles andere als übertrieben.

 www.derstandard.at
www.derstandard.at
Für einen Kompromiss müssen alle Beteiligten über ihren Schatten springen. Dass die nationalen Beiträge nicht steigen sollen, könnte ein gutes Argument in den einzelnen Mitgliedsstaaten sein
Paul Schmidt, der Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, geht in seinem Gastkommentar auf den Streit über das EU-Budget ein, das bei vielen auf Kritik gestoßen ist.
Der neue EU-Haushaltsplan für die Jahre 2028 bis 2034 sorgt seit seiner Präsentation für gehörig Aufregung. Der Entwurf, den Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als "größer, intelligenter und schlagkräftiger als seine Vorgänger" beschreibt, soll den geänderten geopolitischen Realitäten Rechnung tragen, strategischer und flexibler ausgestaltet sein. Der Beifall zum neuen europäischen Zahlenwerk hält sich trotzdem in Grenzen.
Zweitausend Milliarden Euro sollen der Union in der nächsten siebenjährigen Finanzperiode zur Verfügung stehen. Das klingt nach viel, ist auch deutlich mehr als zuletzt, und doch entspricht es lediglich 1,26 Prozent des EU-Bruttonationaleinkommens. Angesichts der aktuellen Problemlagen, der weiter steigenden Erwartungen an "Europa" sowie einer sich immer rauer gebärdenden globalen Umgebung ist der Vorschlag jedenfalls alles andere als übertrieben.

Warum das EU-Budget nicht überambitioniert ist
Für einen Kompromiss müssen alle Beteiligten über ihren Schatten springen. Dass die nationalen Beiträge nicht steigen sollen, könnte ein gutes Argument in den einzelnen Mitgliedsstaaten sein