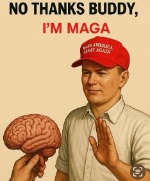Finanzierungsdruck für öffentliche US-Medien wächst
Weiterer Rückschlag für den öffentlichen Rundfunk in den USA: Die für die Finanzierung wichtige Gesellschaft CPB stellt ihren Betrieb ein. Die Corporation for Public Broadcasting kündigte an, den Großteil der Belegschaft bis Ende September zu entlassen. Ein kleines Übergangsteam soll den Betrieb bis Jänner abwickeln.
„Trotz der außerordentlichen Bemühungen von Millionen von Amerikanern, die den Kongress angerufen, angeschrieben und Petitionen eingereicht haben (…), stehen wir nun vor der schwierigen Realität, unseren Betrieb einstellen zu müssen“, so CPB-Präsidentin Patricia Harrison gestern.
Hintergrund ist ein Gesetz, das die republikanische Mehrheit im US-Kongress kürzlich verabschiedet hatte. Es sieht Einsparungen in Höhe von etwa neun Milliarden US-Dollar (etwa 7,7 Mrd. Euro) vor – darunter auch bereits zugesagte Mittel für CPB in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar.
Kein Mittel im Haushaltsentwurf vorgesehen
CPB verwies auch auf einen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr, der aktuell im Senat liegt und „erstmals seit mehr als fünf Jahrzehnten keine Mittel für CPB“ vorsehe. Die nicht kommerzielle Gesellschaft CPB ist seit ihrer Gründung 1967 für die Verteilung der Bundesmittel an den öffentlichen Rundfunk in den USA zuständig.
Weiterer Rückschlag für den öffentlichen Rundfunk in den USA: Die für die Finanzierung wichtige Gesellschaft CPB stellt ihren Betrieb ein. Die Corporation for Public Broadcasting kündigte an, den Großteil der Belegschaft bis Ende September zu entlassen. Ein kleines Übergangsteam soll den Betrieb bis Jänner abwickeln.
„Trotz der außerordentlichen Bemühungen von Millionen von Amerikanern, die den Kongress angerufen, angeschrieben und Petitionen eingereicht haben (…), stehen wir nun vor der schwierigen Realität, unseren Betrieb einstellen zu müssen“, so CPB-Präsidentin Patricia Harrison gestern.
Hintergrund ist ein Gesetz, das die republikanische Mehrheit im US-Kongress kürzlich verabschiedet hatte. Es sieht Einsparungen in Höhe von etwa neun Milliarden US-Dollar (etwa 7,7 Mrd. Euro) vor – darunter auch bereits zugesagte Mittel für CPB in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar.
Kein Mittel im Haushaltsentwurf vorgesehen
CPB verwies auch auf einen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr, der aktuell im Senat liegt und „erstmals seit mehr als fünf Jahrzehnten keine Mittel für CPB“ vorsehe. Die nicht kommerzielle Gesellschaft CPB ist seit ihrer Gründung 1967 für die Verteilung der Bundesmittel an den öffentlichen Rundfunk in den USA zuständig.