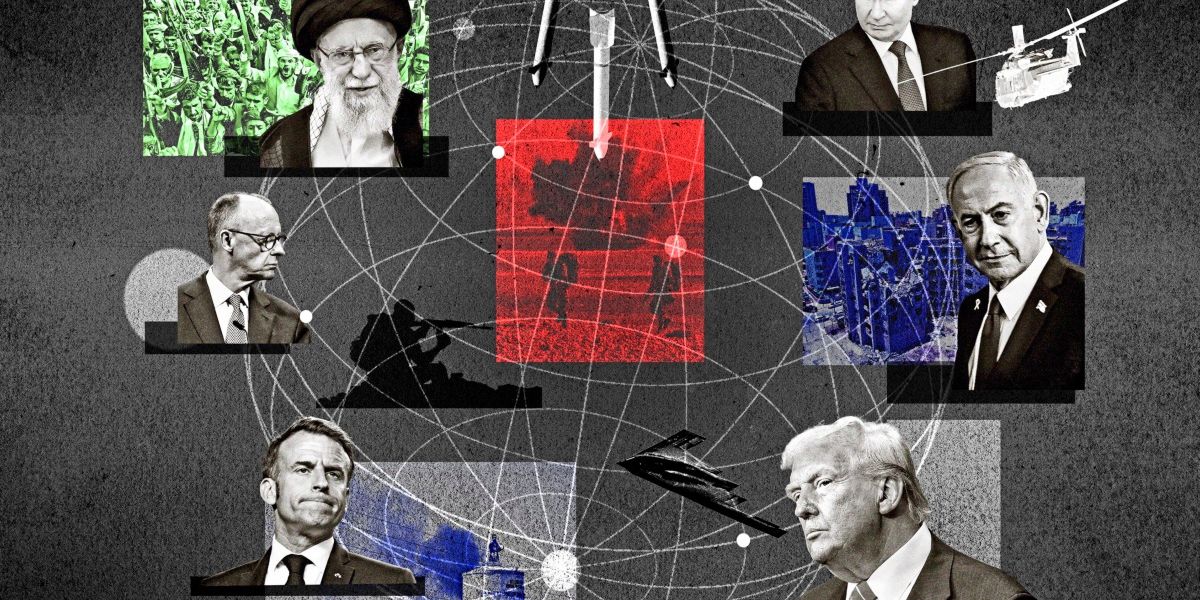Klimakrise, Armut, Diskriminierung: Kindermangel aus Mangel an Verantwortung
Weiter schiebt man Frauen die Verantwortung für Kinder zu – und wundert über niedrige Geburtenraten. Wo bleibt die gemeinsame Verantwortung, eine Welt zu schaffen, in die man gerne Kinder setzt und Eltern ist?
Vor ein paar Jahren war die Sache noch relativ klar: Überdurchschnittlich hohe Geburtenraten gibt es entweder in Ländern, in denen Frauen kaum bis gar keine Reproduktionsrechte haben, oder in Ländern, in denen sie sich möglichst frei und selbstbestimmt mit Unterstützung für oder gegen Kinder entscheiden können. Entweder umfassende Entmündigung oder maximale Gleichberechtigung. Für alle dazwischen war und ist es schwierig.
Italien hat zum Beispiel gerade einen historischen Tiefstand erreicht. Bambinibegeisterung allein reicht einfach nicht aus, wenn junge Erwachsene keine Wohnung finden, es wirtschaftliche und politische Probleme gibt, kaum ausreichende Unterstützung, dafür aber ein Großaufgebot an patriarchalen Rollenzuschreibungen, die menschenfeindlich und vollkommen gegenwartsuntauglich sind. Angesichts unserer vier gemeinsamen Kinder hat das eine italienische Flughafenmitarbeiterin gegenüber meiner Lebenskomplizin mal so auf den Punkt gebracht: "Sie sind eine mutige Frau!"
Aber in Deutschland, Österreich und vielen anderen Ländern sieht es auch nicht wirklich besser aus. Industrienationen, die sich eine demokratische Verfassung geben und auf Menschenrechte schwören, während sie gleichzeitig Frauen diskriminieren, Femizide verharmlosen und familienfeindliche Politik machen, bekommen das mit dem Nachwuchs nicht gerade gut hin. Besonders deutlich wird das in Südkorea. Eine ganze Generation von jungen Frauen fragt sich da vollkommen zu Recht, warum sie teure und langwierige Ausbildungen abschließen sollen, nur um nach Ehe und Geburt von ihren gut bezahlten Jobs abberufen und an den Herd befohlen zu werden. Der permanente Spagat zwischen Unmündigkeit und Emanzipation zerreißt die Betroffenen und führt immer häufiger zu der Entscheidung: Dann lieber nicht! Nicht hier, nicht jetzt, nicht unter diesen Bedingungen.

 www.derstandard.at
www.derstandard.at
Weiter schiebt man Frauen die Verantwortung für Kinder zu – und wundert über niedrige Geburtenraten. Wo bleibt die gemeinsame Verantwortung, eine Welt zu schaffen, in die man gerne Kinder setzt und Eltern ist?
Vor ein paar Jahren war die Sache noch relativ klar: Überdurchschnittlich hohe Geburtenraten gibt es entweder in Ländern, in denen Frauen kaum bis gar keine Reproduktionsrechte haben, oder in Ländern, in denen sie sich möglichst frei und selbstbestimmt mit Unterstützung für oder gegen Kinder entscheiden können. Entweder umfassende Entmündigung oder maximale Gleichberechtigung. Für alle dazwischen war und ist es schwierig.
Italien hat zum Beispiel gerade einen historischen Tiefstand erreicht. Bambinibegeisterung allein reicht einfach nicht aus, wenn junge Erwachsene keine Wohnung finden, es wirtschaftliche und politische Probleme gibt, kaum ausreichende Unterstützung, dafür aber ein Großaufgebot an patriarchalen Rollenzuschreibungen, die menschenfeindlich und vollkommen gegenwartsuntauglich sind. Angesichts unserer vier gemeinsamen Kinder hat das eine italienische Flughafenmitarbeiterin gegenüber meiner Lebenskomplizin mal so auf den Punkt gebracht: "Sie sind eine mutige Frau!"
Aber in Deutschland, Österreich und vielen anderen Ländern sieht es auch nicht wirklich besser aus. Industrienationen, die sich eine demokratische Verfassung geben und auf Menschenrechte schwören, während sie gleichzeitig Frauen diskriminieren, Femizide verharmlosen und familienfeindliche Politik machen, bekommen das mit dem Nachwuchs nicht gerade gut hin. Besonders deutlich wird das in Südkorea. Eine ganze Generation von jungen Frauen fragt sich da vollkommen zu Recht, warum sie teure und langwierige Ausbildungen abschließen sollen, nur um nach Ehe und Geburt von ihren gut bezahlten Jobs abberufen und an den Herd befohlen zu werden. Der permanente Spagat zwischen Unmündigkeit und Emanzipation zerreißt die Betroffenen und führt immer häufiger zu der Entscheidung: Dann lieber nicht! Nicht hier, nicht jetzt, nicht unter diesen Bedingungen.

Klimakrise, Armut, Diskriminierung: Kindermangel aus Mangel an Verantwortung
Weiter schiebt man Frauen die Verantwortung für Kinder zu – und wundert über niedrige Geburtenraten. Wo bleibt die gemeinsame Verantwortung, eine Welt zu schaffen, in die man gerne Kinder setzt und Eltern ist?