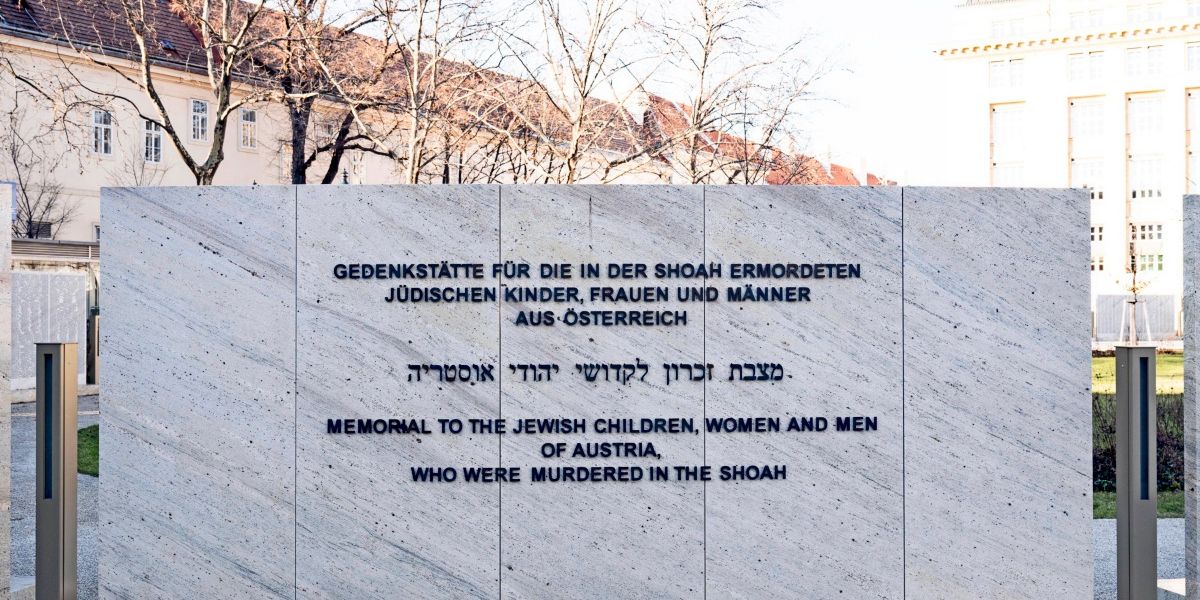Die diesmal nicht wählen durften
Einige hunderttausend Wienbewohner sind keine Staatsbürger und haben keine demokratischen Rechte
In Wien haben 45 Prozent einen sogenannten Migrationshintergrund (entweder man selbst oder die Eltern sind im Ausland geboren). Ohne diese Menschen mit serbischem, türkischem, deutschem, rumänischem, ungarischem, polnischem, arabischem etc. Hintergrund kann Wien zusperren.
Die gesamte Dienstleistungsbranche wird von diesen Menschen bestimmt: Obsthändler, Taxifahrer, Pflegepersonal in Krankenhäusern und in der Heimpflege, Supermarktkassiererinnen, Handwerker aller Art, Bedienstete der städtischen Betriebe, Bauarbeiter, Verkäuferinnen, Steuerberaterinnen, Arzthelferinnen, Pharmazeutinnen.
Das sind Menschen mit und ohne Staatsbürgerschaft. Es leben aber rund 35 Prozent über 16 Jahre ohne Staatsbürgerschaft in Wien. Das sind Hunderttausende, die jetzt nicht wählen durften. Sehr viele davon sind schon hier geboren oder als kleine Kinder gekommen, sie sprechen gut bis perfekt Deutsch, gingen oder gehen hier zur Schule und arbeiten hier. Sie werden nie wieder weggehen.
Ihnen wird "das hohe Gut" der Staatsbürgerschaft (ÖVP- und FPÖ-Sprech) de facto verweigert. Es stimmt: Etliche sind zu stark in ihrem eigenen Kulturkreis verhaftet. Aber sehr vielen Jungen ist die Staatsbürgerschaft zu teuer und zu schikanös gestaltet. Es ist aber ein demokratischer Wahnsinn, junge Menschen, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben, de facto nicht wählen zu lassen. (Hans Rauscher, 28.4.2025)

 www.derstandard.at
www.derstandard.at
Einige hunderttausend Wienbewohner sind keine Staatsbürger und haben keine demokratischen Rechte
In Wien haben 45 Prozent einen sogenannten Migrationshintergrund (entweder man selbst oder die Eltern sind im Ausland geboren). Ohne diese Menschen mit serbischem, türkischem, deutschem, rumänischem, ungarischem, polnischem, arabischem etc. Hintergrund kann Wien zusperren.
Die gesamte Dienstleistungsbranche wird von diesen Menschen bestimmt: Obsthändler, Taxifahrer, Pflegepersonal in Krankenhäusern und in der Heimpflege, Supermarktkassiererinnen, Handwerker aller Art, Bedienstete der städtischen Betriebe, Bauarbeiter, Verkäuferinnen, Steuerberaterinnen, Arzthelferinnen, Pharmazeutinnen.
Das sind Menschen mit und ohne Staatsbürgerschaft. Es leben aber rund 35 Prozent über 16 Jahre ohne Staatsbürgerschaft in Wien. Das sind Hunderttausende, die jetzt nicht wählen durften. Sehr viele davon sind schon hier geboren oder als kleine Kinder gekommen, sie sprechen gut bis perfekt Deutsch, gingen oder gehen hier zur Schule und arbeiten hier. Sie werden nie wieder weggehen.
Ihnen wird "das hohe Gut" der Staatsbürgerschaft (ÖVP- und FPÖ-Sprech) de facto verweigert. Es stimmt: Etliche sind zu stark in ihrem eigenen Kulturkreis verhaftet. Aber sehr vielen Jungen ist die Staatsbürgerschaft zu teuer und zu schikanös gestaltet. Es ist aber ein demokratischer Wahnsinn, junge Menschen, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben, de facto nicht wählen zu lassen. (Hans Rauscher, 28.4.2025)

Die diesmal nicht wählen durften
Einige hunderttausend Wienbewohner sind keine Staatsbürger und haben keine demokratischen Rechte