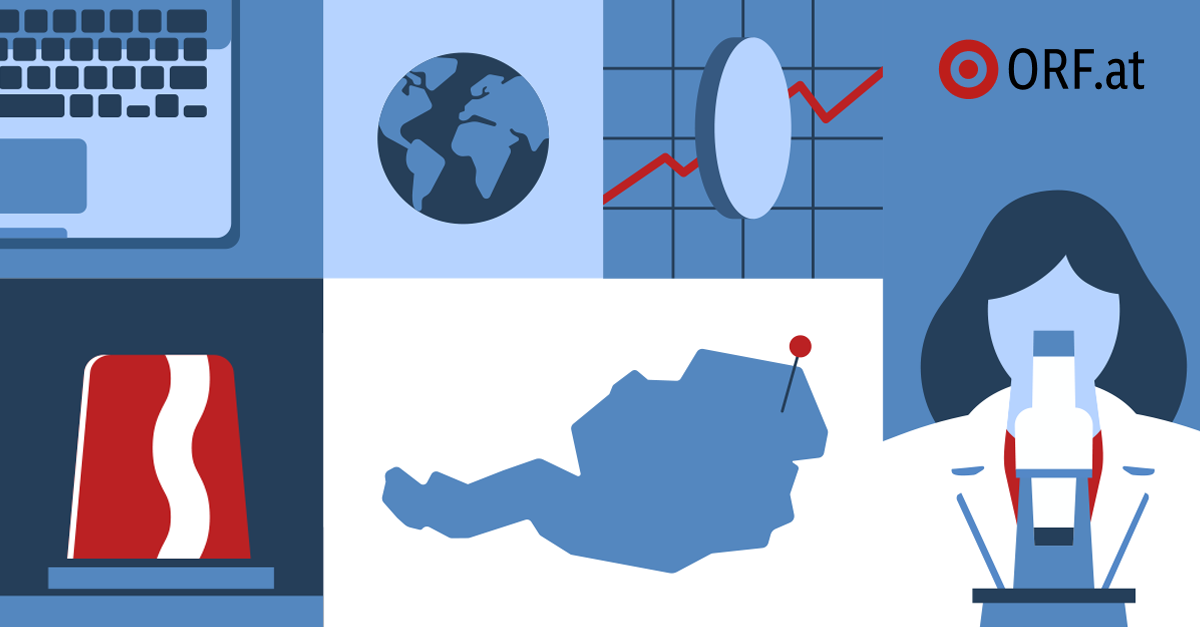Sierra Leone in den Fängen der Droge Kush
Der Präsident von Sierra Leone, Julius Maada Bio, hat wegen des hohen Drogenkonsums in dem westafrikanischen Staat den Notstand ausgerufen. „Unser Land steht derzeit vor einer existenziellen Bedrohung durch die verheerenden Auswirkungen von Drogen und Drogensucht, vor allem durch die synthetische Droge Kush“, sagte Bio in der Nacht auf Freitag in einer Rede an die Nation. Schätzungsweise ein Dutzend Menschen sterben in Sierra Leone pro Woche an dem gefährlichen Rauschgiftmix.
Kush tauchte vor wenigen Jahren erstmals in Sierra Leone auf. Die von kriminellen Banden hergestellte und vertriebene Droge kostet in der Regel fünf Leones (20 Cent) pro Joint, viele Konsumenten und Konsumentinnen geben jedoch mehr als neun Euro pro Tag aus – ein Vermögen für ein Land mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen von unter 500 Euro pro Jahr. Mit der traditionellen Cannabissorte Kush, die ursprünglich aus der Region des Hindukusch-Gebirges in Zentralasien stammt, hat das neue Rauschgift nichts gemein.

 orf.at
orf.at
Der Präsident von Sierra Leone, Julius Maada Bio, hat wegen des hohen Drogenkonsums in dem westafrikanischen Staat den Notstand ausgerufen. „Unser Land steht derzeit vor einer existenziellen Bedrohung durch die verheerenden Auswirkungen von Drogen und Drogensucht, vor allem durch die synthetische Droge Kush“, sagte Bio in der Nacht auf Freitag in einer Rede an die Nation. Schätzungsweise ein Dutzend Menschen sterben in Sierra Leone pro Woche an dem gefährlichen Rauschgiftmix.
Kush tauchte vor wenigen Jahren erstmals in Sierra Leone auf. Die von kriminellen Banden hergestellte und vertriebene Droge kostet in der Regel fünf Leones (20 Cent) pro Joint, viele Konsumenten und Konsumentinnen geben jedoch mehr als neun Euro pro Tag aus – ein Vermögen für ein Land mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen von unter 500 Euro pro Jahr. Mit der traditionellen Cannabissorte Kush, die ursprünglich aus der Region des Hindukusch-Gebirges in Zentralasien stammt, hat das neue Rauschgift nichts gemein.

Notstand verhängt: Sierra Leone in den Fängen der Droge Kush
Der Präsident von Sierra Leone, Julius Maada Bio, hat wegen des hohen Drogenkonsums in dem westafrikanischen Staat den Notstand ausgerufen. „Unser Land steht derzeit vor einer existenziellen Bedrohung durch die verheerenden Auswirkungen von Drogen und Drogensucht, vor allem durch die...