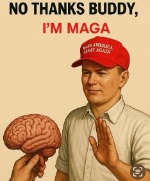Texas unter Wasser – Wie ein Sommerlager zur Todesfalle wurde – Wie das Trump-Regime versagte
In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli verwandelte sich der Himmel über dem texanischen Hill Country in einen schwarzen Abgrund. Innerhalb weniger Stunden fiel so viel Regen wie sonst in mehreren Monaten. Der Guadalupe River, normalerweise ein klarer, ruhiger Strom, schwoll an zu einer tobenden Mauer aus Schlamm, Treibgut und Tod. Als der Morgen graute, waren 24 Menschen tot, mindestens 23 Mädchen aus dem christlichen Sommercamp „Camp Mystic“ wurden vermisst – verschollen in einer Landschaft, die binnen Minuten zu einem albtraumhaften Irrgarten aus zerstörten Brücken, zerschmetterten Bäumen und zerrissenen Erinnerungen wurde. Was sich in Kerrville und Hunt abspielte, ist nicht nur eine Naturkatastrophe. Es ist auch ein menschliches und politisches Versagen – das Resultat Demontage öffentlicher Infrastruktur unter der Trump-Regierung. Warnsysteme, die einst Sirenen auslösten, Push-Nachrichten verschickten oder automatische Evakuierungen vorbereiteten, sind in vielen Teilen des Landes stillgelegt oder privatisiert worden. In Kerr County, wie ein Beamter auf Nachfrage einräumte, existiert kein funktionierendes Hochwasser-Warnsystem mehr. „Wir haben keine“, sagte County Judge Rob Kelly schlicht. Statt Sirenen: Stille. Dabei hatten Meteorologen schon Stunden vor dem Sturm gewarnt. Das National Weather Service sprach von 3 bis 6 Zoll Regen, es wurden über 10. Innerhalb von 45 Minuten stieg der Guadalupe River auf über 26 Fuß – das Messgerät selbst wurde überflutet. In der Finsternis war das Wasser plötzlich da – und nahm alles mit.

 kaizen-blog.org
kaizen-blog.org
In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli verwandelte sich der Himmel über dem texanischen Hill Country in einen schwarzen Abgrund. Innerhalb weniger Stunden fiel so viel Regen wie sonst in mehreren Monaten. Der Guadalupe River, normalerweise ein klarer, ruhiger Strom, schwoll an zu einer tobenden Mauer aus Schlamm, Treibgut und Tod. Als der Morgen graute, waren 24 Menschen tot, mindestens 23 Mädchen aus dem christlichen Sommercamp „Camp Mystic“ wurden vermisst – verschollen in einer Landschaft, die binnen Minuten zu einem albtraumhaften Irrgarten aus zerstörten Brücken, zerschmetterten Bäumen und zerrissenen Erinnerungen wurde. Was sich in Kerrville und Hunt abspielte, ist nicht nur eine Naturkatastrophe. Es ist auch ein menschliches und politisches Versagen – das Resultat Demontage öffentlicher Infrastruktur unter der Trump-Regierung. Warnsysteme, die einst Sirenen auslösten, Push-Nachrichten verschickten oder automatische Evakuierungen vorbereiteten, sind in vielen Teilen des Landes stillgelegt oder privatisiert worden. In Kerr County, wie ein Beamter auf Nachfrage einräumte, existiert kein funktionierendes Hochwasser-Warnsystem mehr. „Wir haben keine“, sagte County Judge Rob Kelly schlicht. Statt Sirenen: Stille. Dabei hatten Meteorologen schon Stunden vor dem Sturm gewarnt. Das National Weather Service sprach von 3 bis 6 Zoll Regen, es wurden über 10. Innerhalb von 45 Minuten stieg der Guadalupe River auf über 26 Fuß – das Messgerät selbst wurde überflutet. In der Finsternis war das Wasser plötzlich da – und nahm alles mit.

Texas unter Wasser – Wie ein Sommerlager zur Todesfalle wurde - Wie das Trump-Regime versagte
In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli verwandelte sich der Himmel über dem texanischen Hill Country in einen schwarzen Abgrund. Innerhalb weniger Stunden fiel so viel Regen wie sonst in mehreren Monaten. Der Guadalupe River, normalerweise ein klarer, ruhiger Strom, schwoll an zu einer tobenden...