Gottes Werk, Trumps Wille – Wie Pete Hegseth den Kulturkampf zur Regierungspolitik macht
Es gibt politische Gesten, die mehr sagen als jede Rede – und die in ihrer Symbolik schwerer wiegen als jede spontane Äußerung. Als US-Verteidigungsminister Pete Hegseth nun ein Video weiterverbreitete, in dem ein führender Kopf der christlich-evangelikalen Bewegung zur Wiedereinführung eines Gesetzesverbots für gleichgeschlechtlichen Sex aufruft, war das eine solche Geste. Kein Missverständnis, keine zufällige Like-Geste in sozialen Medien – sondern eine bewusste, öffentliche Verstärkung einer Botschaft, die tief in die Zeit vor entscheidende Bürgerrechtsurteile zurückreicht. In dem Clip spricht Doug Wilson, Mitbegründer der Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC) und langjähriger Mentor Hegseths, mit nostalgischem Unterton über eine Epoche, in der Sodomie in allen 50 Bundesstaaten ein Verbrechen war. Er nennt es ausdrücklich keine totalitäre Hölle – sondern deutet an, dass ein solches strafrechtliches Verbot Ausdruck einer gesunden Gesellschaft sei. Damit reaktiviert Wilson nicht nur ein gesellschaftspolitisches Weltbild, das längst als Relikt autoritärer Kontrolle gilt, sondern stellt sich offen gegen die Grundpfeiler moderner Gleichberechtigung. Dass Hegseth genau diesen Clip teilt, ist kein unbedeutender Ausrutscher, sondern ein politisches Statement – ein Bekenntnis zu einer reaktionären Agenda, die seit Jahren im Windschatten der Republikanischen Partei gedeiht. Hegseth, der sich selbst als gläubiger Christ inszeniert und von Donald Trump zum Verteidigungsminister gemacht wurde, pflegt eine enge Verbindung zu Wilson und dessen CREC-Netzwerk. Diese Bewegung ist bekannt für ihre fundamentalistische Bibelauslegung, ihre patriarchale Geschlechterordnung und ihre gezielte Einflussnahme auf Bildungseinrichtungen und Lokalpolitik.

 kaizen-blog.org
kaizen-blog.org
Es gibt politische Gesten, die mehr sagen als jede Rede – und die in ihrer Symbolik schwerer wiegen als jede spontane Äußerung. Als US-Verteidigungsminister Pete Hegseth nun ein Video weiterverbreitete, in dem ein führender Kopf der christlich-evangelikalen Bewegung zur Wiedereinführung eines Gesetzesverbots für gleichgeschlechtlichen Sex aufruft, war das eine solche Geste. Kein Missverständnis, keine zufällige Like-Geste in sozialen Medien – sondern eine bewusste, öffentliche Verstärkung einer Botschaft, die tief in die Zeit vor entscheidende Bürgerrechtsurteile zurückreicht. In dem Clip spricht Doug Wilson, Mitbegründer der Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC) und langjähriger Mentor Hegseths, mit nostalgischem Unterton über eine Epoche, in der Sodomie in allen 50 Bundesstaaten ein Verbrechen war. Er nennt es ausdrücklich keine totalitäre Hölle – sondern deutet an, dass ein solches strafrechtliches Verbot Ausdruck einer gesunden Gesellschaft sei. Damit reaktiviert Wilson nicht nur ein gesellschaftspolitisches Weltbild, das längst als Relikt autoritärer Kontrolle gilt, sondern stellt sich offen gegen die Grundpfeiler moderner Gleichberechtigung. Dass Hegseth genau diesen Clip teilt, ist kein unbedeutender Ausrutscher, sondern ein politisches Statement – ein Bekenntnis zu einer reaktionären Agenda, die seit Jahren im Windschatten der Republikanischen Partei gedeiht. Hegseth, der sich selbst als gläubiger Christ inszeniert und von Donald Trump zum Verteidigungsminister gemacht wurde, pflegt eine enge Verbindung zu Wilson und dessen CREC-Netzwerk. Diese Bewegung ist bekannt für ihre fundamentalistische Bibelauslegung, ihre patriarchale Geschlechterordnung und ihre gezielte Einflussnahme auf Bildungseinrichtungen und Lokalpolitik.

Gottes Werk, Trumps Wille – Wie Pete Hegseth den Kulturkampf zur Regierungspolitik macht
Die Signalwirkung des geteilten Videos reicht weit über die Kreise eingefleischter Kulturkämpfer hinaus. In einer Zeit, in der die Trump-Regierung bereits juristische und administrative Hebel nutzt, um LGBTQ-Rechte zurückzudrehen, wirkt Hegseths Beitrag wie ein bewusst gesetztes Zeichen: Die...





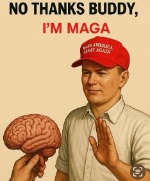
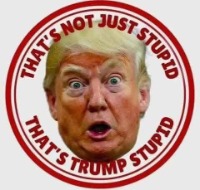

 Der würde wahrscheinlich die desintegration von Donald empfehlen. Unverzüglich zum Wohlergehen der menschlichen Zivilisation. Wir haben keine Zeit für so einen bullshit.
Der würde wahrscheinlich die desintegration von Donald empfehlen. Unverzüglich zum Wohlergehen der menschlichen Zivilisation. Wir haben keine Zeit für so einen bullshit.