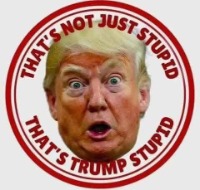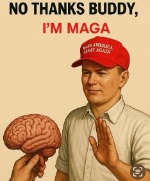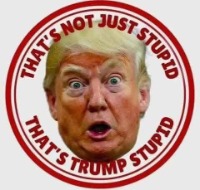Willkommen bald im Wilden Westen – Trumps Stromfalle
Es war einmal ein Land, das sich für unerschütterlich hielt. Ein Land, in dem der Strom floss wie das Wasser in einem endlosen Flussbett, ein Land, das den Fortschritt pries und die Sicherheit als selbstverständlich betrachtete. Doch dann kamen die Zölle, und mit ihnen das Klirren der Ketten. Große Transformatoren, so groß wie Häuser, schwer wie eine halbe Million Kilo, standen plötzlich wie verstaubte Monumente in den Fabrikhallen jener Länder, die sie noch herstellten. Japan, Deutschland, Südkorea – einst Partner, nun Zielscheiben in einem Zirkus der Zölle.
Donald Trump, der große Bezwinger der Globalisierung, versprach eine neue Ära der Stärke. „America First“, rief er, und die Menge jubelte. Doch was er baute, war kein Bollwerk gegen Bedrohungen, sondern ein Kartenhaus. Ein Netz, so fragil wie Spinnweben im Sturm. Denn die Realität war, dass Amerika nicht einmal ein Fünftel seiner Transformatoren selbst herstellte. Der Rest kam von jenen Nationen, die Trump nun mit Zöllen belegte – bis zu 145 Prozent.
Und während die Preise für Ersatzteile stiegen, sanken die Vorräte. Es gab keine strategische Reserve, keine Ersatz-Transformatoren für den Ernstfall. Ein Sonnensturm, ein Terroranschlag – und die Lichter könnten ausgehen. Nicht für Minuten, sondern für Tage, Wochen. Es wäre kein Stromausfall, es wäre ein Zusammenbruch.
Man muss sich das vorstellen: General Electric, der letzte große US-Hersteller von Leistungstransformatoren, ist wie ein Riese mit gefesselten Händen. Das Unternehmen könnte liefern, doch es fehlt an dem Material – an speziellem Stahl, den Amerika nicht produziert. Dieser Stahl kommt aus Japan. Aber der Preis, der Preis – und die Wartezeit. Zwei Jahre für Standardmodelle, fünf Jahre für Sonderanfertigungen.
Doch was tut Trump, der Mann, der von Stärke spricht? Er zerstört die Institutionen, die Schutz bieten könnten. NOAA, die nationale Wetterbehörde, sieht ihre Programme gestrichen. Das CDC, einst der Schutzwall gegen Pandemien, wird entkernt. Beamte, die wissen, wie man Krisen managt, werden entlassen. Schedule F, nennt man das. Ein neuer Wilder Westen, in dem Loyalität mehr zählt als Kompetenz.