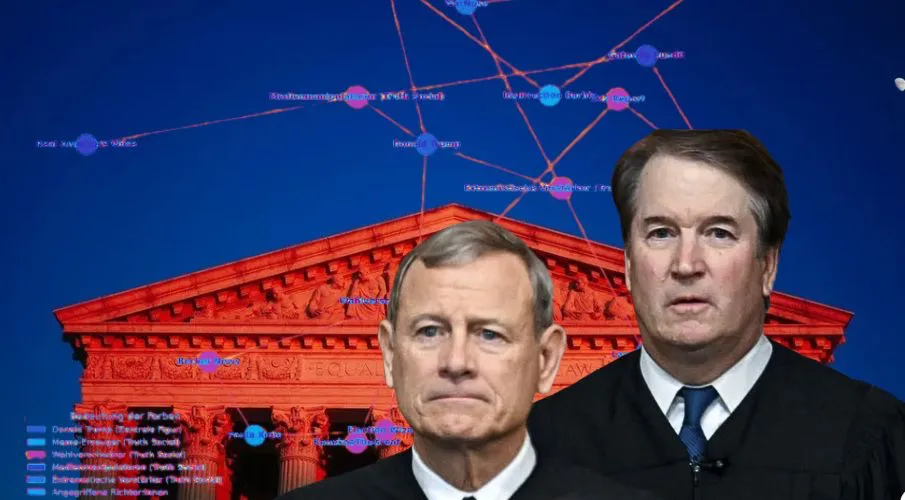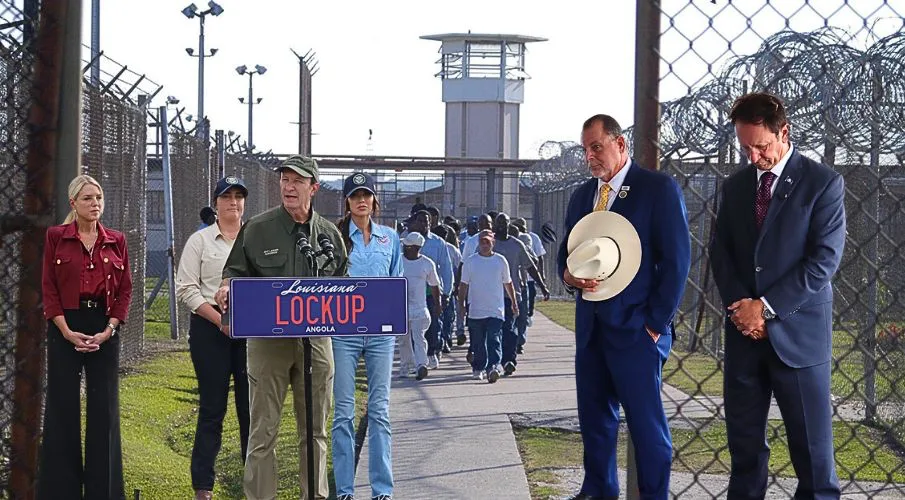„Scharlatan“: US-Gesundheitsminister Kennedy muss sich im Senat scharfer Kritik stellen
In einer stürmischen Anhörung im US-Senat verteidigt Gesundheitsminister Robert F. Kennedy seinen bisherigen Kurs. Die Demokraten fordern seinen Rücktritt, „bevor er noch mehr Menschen schadet“.
In einer stürmischen Anhörung im US-Senat hat Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. die Entlassung von Gesundheitsbehörden-Chefin Susan Monarez verteidigt. Ihr Rauswurf sei „absolut notwendig“ für einen Kurswechsel gewesen, sagte der als Impfkritiker bekannte Kennedy am Donnerstag in Washington. Die oppositionellen Demokraten bezichtigten den Neffen des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy der Lüge und forderten seinen Rücktritt.
Kennedy griff die Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in der Anhörung scharf an. Diese habe während der Corona-Pandemie eine „katastrophale und unsinnige“ Politik betrieben, sagte er unter Anspielung auf die Impfprogramme. „Wir brauchen mutige, kompetente und kreative neue Führungskräfte bei der CDC“, die wie er „einen neuen Kurs“ verträten.
„Ich bestand auf sorgfältige wissenschaftliche Prüfungen. Deswegen wurde ich gefeuert“
Das Weiße Haus hatte die CDC-Chefin und Mikrobiologin Monarez Ende August nach weniger als einem Monat im Amt entlassen, nachdem sie sich mit Kennedy überworfen hatte. Unter anderem hatte Monarez sich geweigert, aus ihrer Sicht fragwürdige Anweisungen umzusetzen.

 www.tagesspiegel.de
www.tagesspiegel.de
In einer stürmischen Anhörung im US-Senat verteidigt Gesundheitsminister Robert F. Kennedy seinen bisherigen Kurs. Die Demokraten fordern seinen Rücktritt, „bevor er noch mehr Menschen schadet“.
In einer stürmischen Anhörung im US-Senat hat Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. die Entlassung von Gesundheitsbehörden-Chefin Susan Monarez verteidigt. Ihr Rauswurf sei „absolut notwendig“ für einen Kurswechsel gewesen, sagte der als Impfkritiker bekannte Kennedy am Donnerstag in Washington. Die oppositionellen Demokraten bezichtigten den Neffen des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy der Lüge und forderten seinen Rücktritt.
Kennedy griff die Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in der Anhörung scharf an. Diese habe während der Corona-Pandemie eine „katastrophale und unsinnige“ Politik betrieben, sagte er unter Anspielung auf die Impfprogramme. „Wir brauchen mutige, kompetente und kreative neue Führungskräfte bei der CDC“, die wie er „einen neuen Kurs“ verträten.
„Ich bestand auf sorgfältige wissenschaftliche Prüfungen. Deswegen wurde ich gefeuert“
Das Weiße Haus hatte die CDC-Chefin und Mikrobiologin Monarez Ende August nach weniger als einem Monat im Amt entlassen, nachdem sie sich mit Kennedy überworfen hatte. Unter anderem hatte Monarez sich geweigert, aus ihrer Sicht fragwürdige Anweisungen umzusetzen.

„Scharlatan“: US-Gesundheitsminister Kennedy muss sich im Senat scharfer Kritik stellen
In einer stürmischen Anhörung im US-Senat verteidigt Gesundheitsminister Robert F. Kennedy seinen bisherigen Kurs. Die Demokraten fordern seinen Rücktritt, „bevor er noch mehr Menschen schadet“.